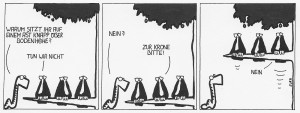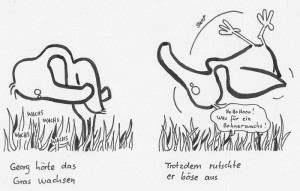Manchmal liest man an Stellen, an denen man es nicht vermutet, einen unscheinbaren kurzen Satz, stutzt, denkt sich „Na sieh mal an“ – und ertappt sich wenig später dabei, dem beschriebenen Sachverhalt nachzugehen, statt vernünftige Dinge zu tun (sagen wir: die Treppe wischen).
In meinem Fall war es ein Satz aus der Einleitung der Gedichtsammlung „Deutschlands Dichter von 1813 bis 1843“. Da schreibt Karl Gödeke über den Pentameter:
„Auch haben die Griechen häufig, die Römer regelmäßig und die besseren deutschen Dichter mit Sorgfalt die zweite Hälfte mit einer Zäsur nach der fünften Silbe ausgestattet, so dass der Ausgang jambisch wird“.
Ach. Soll heißen, im Silbenbild dargestellt:
TAM ta (ta) TAM ta (ta) TAM || TAM ta ta TAM ta | ta TAM
Wobei „|“ die von Gödeke angesprochene Zäsur ist. Ich habe nun wirklich schon viele – deutsche! – Distichen, und damit Pentamter gelesen und geschrieben; aber das war mir noch nicht aufgefallen!
Denkt man über die zweite Pentameterhälfte nach, die ja eine feste Silbenverteilung hat, wird schnell klar, dass sie auf insgesamt sechzehn verschiedene Arten mit Sinneinheiten, oder, wie man auch sagt: Wortfüßen gefüllt werden kann: Neun davon enthalten drei Wortfüße (auf jede der drei betonten Silbe entfällt einer, weswegen auch mehr als drei Wortfüße nicht möglich sind), sechs enthalten zwei Wortfüße (ein Wortfuß enthält zwei betonte Silben, ein Wortfuß eine betonte Silbe), und einmal erstreckt sich der Wortfuß über den ganzen Halbvers und enthält alle drei betonten Silben. Im Silbenbild sieht das so aus:
01 TAM / ta ta TAM ta ta / TAM
02 TAM / ta ta TAM ta / ta TAM
03 TAM / ta ta TAM / ta ta TAM
04 TAM ta / ta TAM ta ta / TAM
05 TAM ta / ta TAM ta / ta TAM
06 TAM ta / ta TAM / ta ta TAM
07 TAM ta ta / TAM ta ta / TAM
08 TAM ta ta / TAM ta / ta TAM
09 TAM ta ta / TAM / ta ta TAM
10 TAM / ta ta TAM ta ta TAM
11 TAM ta / ta TAM ta ta TAM
12 TAM ta ta / TAM ta ta TAM
13 TAM ta ta TAM / ta ta TAM
14 TAM ta ta TAM ta / ta TAM
15 TAM ta ta TAM ta ta / TAM
16 TAM ta ta TAM ta ta TAM
Man sieht: das bei der von Gödeke erwähnten Zäsur enstehende „ta TAM“ findet sich bei vier der sechzehn Möglichkeiten. Jetzt könnte man einen in Distichen geschriebenen Text nehmen und einfach nachzählen: Kommen diese vier Möglichkeiten in ungefähr einem Viertel der Verse vor, hat Gödeke Unrecht; kommen sie in wesentlich mehr Versen vor, hat er Recht!
Aber so einfach ist es dann doch nicht, denn die verschiedenen Möglichkeiten sind nicht gleichwertig, was an den Möglichkeiten liegt, die der Wortschatz des Deutschen bietet; und sein Satzbau. Wer selbst Hexameter und Distichen schreibt, weiß, wie häufig sich Wortfüße der Form „ta TAM ta“ in die Verse drängen, die ungeliebten Amphibrachen, gegen deren zu häufiges Vorkommen jeder Hexametrist einen dauernden (und nicht immer erfolgreichen!) Kampf führt …
Diese Amphibrachen entstehen, wenn vor die im Deutschen sehr häufigen zweisilbigen Worte der Form „TAM ta“ ein Bauwort tritt, meist ein Artikel oder eine Präposition. Schaut man sich nun die Liste der sechzehn Möglichkeiten an, sieht man: es gibt nur eine einzige Wortfußanordnung, in der ein Amphibrach vorkommt! Diese: „TAM ta / ta TAM ta / ta TAM“
Und wenn man bedenkt, das auch der erste Wortfuß eines der häufigen Wörter der Form „TAM ta“ aufnehmen kann, ist der Verdacht nicht fern, dass diese Wortfußverteilung sehr häufig vertreten sein wird! Aber eigentlich nicht darum, weil der Dichter „sorgsam“ war, wie Gödeke sagt; sondern eher, weil er sorglos war und den Vorgaben des Deutschen bequem gefolgt ist …
Also, bei wem könnte man nachschauen?! Friedrich Schiller bietet sich an mit seinem Spaziergang; einmal, weil Schiller den eigentlichen, tiefen Einschnitt genau in der Mitte des Pentamters meist stark betont und so die zweite Vershälfte zuverlässig von der ersten trennt; und auch, weil der Spaziergang genau 200 Verse hat, mithin 100 Pentameter – was die Angabe von Prozentwerten erfreulich einfach macht …
Das Ergebnis bestätigt, was vermutet wurde:
29 x TAM ta / ta TAM ta / ta TAM
21 x TAM ta / ta TAM ta ta TAM
13 x TAM / ta ta TAM ta / ta TAM
11 x TAM ta ta TAM ta / ta TAM
7 x TAM ta / ta TAM ta ta / TAM
6 x TAM / ta ta TAM ta ta TAM
5 x TAM ta ta / TAM ta / ta TAM
2 x TAM ta ta TAM ta ta / TAM
2 x TAM / ta ta TAM / ta ta TAM
1 x TAM ta / ta TAM / ta ta TAM
1 x TAM ta ta / TAM / ta ta TAM
1 x TAM ta ta / TAM ta ta TAM
1 x TAM ta ta TAM / ta ta TAM
0 x TAM / ta ta TAM ta ta / TAM
0 x TAM ta ta / TAM ta ta / TAM
0 x TAM ta ta TAM ta ta TAM
Die Wortfußverteilung, die den Amphibrach enthält, ist die deutlich häufigste – auf sie allein entfallen mehr Verse als auf alle Möglichkeiten, die auf den Plätzen 5 – 16 folgen!
Bei der zweithäufigsten Möglichkeit – „TAM ta / ta TAM ta ta TAM“ – lohnt ein näherer Blick. Sie besteht aus zwei Wortfüßen, und der längere könnte durchaus auch einen Amphibrach enthalten, zum Beispiel ein Artikel + Adjektiv, die zusammen mit einem auf sie folgenden Substantiv der Form „ta TAM“ eine Sinneinheit bilden. Tatsächlich finden sich solche Halbverse bei Schiller:
fröhlich / das enge Gesetz
Die meisten Halbverse dieser Art sind aber anders gefüllt, sie enthalten als zweiten Wortfuß Artikel / Präposition + dreisilbiges Adjektiv, gefolgt von einem einsilbigen, betonten Substantiv:
wirbelt / in heiterer Luft
rühmet / das prangende Tal
glühend, / ein einziges Herz
– Und noch viele andere …
Einige der sechzehn Möglichkeiten kommen gar nicht vor. Zumindest bei dem Halbvers, der aus einem einzigen Wortfuß besteht, wundert das nicht: sieben Silben sind viel, meist nimmt das Ohr sie nicht mehr als eine Sinneinheit wahr, sondern „zerlegt“ sie in zwei. In Schillers „Genius“ findet sich so ein Halbvers:
in der entadelten Brust
– Ein siebensilbiger Präpositionalausdruck, der ein wenig schummelt, indem er die eigentlich zu schwache Präposition „in“ auf die Hebungsstelle setzt …
Aber zurück zu Gödekes anfangs genannter Aussage! Ich weiß nicht, ob er Schiller als „besseren Dichter“ angesehen hat; ein Dichter, dessen Formverständnis wahrzunehmen sich lohnt, war er allemal. Und es sieht im Spaziergang so aus, dass 58% der Pentamter zumindest eine Wortfußgrenze vor der vorletzten Silbe haben, also „jambisch ausgehen“; 42% haben eine andere Gliederung.
Ob Schiller das bewusst so gemacht hat, bezweifle ich aus oben genannten Gründen; aber aufschlussreich sind solche Überprüfungen trotzdem, und noch aufschlussreicher, vergleicht man diese Werte mit denen, die sich in den Texten anderer Verfasser zeigen. Ich werde noch einige dahingehend auswerten und die Ergebnisse dann mit denen bei Schiller gefundenen vergleichen …
Bis das erledigt ist, verweise ich noch auf den letzten von mir verfassten Pentameter (er steht im Distichon „Sommerfest„):
„Herrlich!“, er reicht mir, „Famos!“ lächelnd den Teller; und geht.
– Da weisen sogar beide Halbverse die Form „TAM ta / ta TAM ta / ta TAM“ auf; und sie haben beide einen – starken! – Einschnitt nach der fünften Silbe! Ich bin also im Guten ein folgsamer Schüler der „besseren Dichter“; oder im Schlechten einer, der es sich leicht macht und zweimal auf die naheliegendste Lösung zurückgreift …