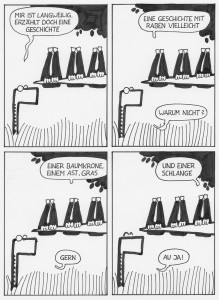Conrad Ferdinand Meyers „Der Kamerad“ ist ein eigenartiger Text!
Mit dem Tode schloss ich Kameradschaft.
Über einem vollen Humpen saßen
Oft wir nächtens und philosophierten.
Auch zusammen gingen wir spazieren,
Lauschten mit elegischen Gefühlen
Nach dem Pilgerruf der Abendglocke.
Aber männlich auch an meiner Seite
Stand der Kamerad und sekundierte,
Oder wann ich im Gebirg verirrt war,
Hangend über schwindelnd tiefem Abgrund,
Sprach er: „Blick mir in das Auge ruhig!“
Und ich tat es und ich war gerettet.
Lange standen wir auf gutem Fuße,
Bis mich volles Leben überströmte
Glühend warm mit unbekannter Fülle,
Und mir schauderte vor meinem Freunde …
Als das Liebchen heute mir am Hals hing,
Über seine Schulter weg erblickt ich
Meines Kameraden leichten Umriss
Auf dem Abendhimmel, und er grollte:
„Bin ich dir verleidet? Deine feigen
Lippen meiden meinen schlichten Namen?
Ist das hübsch von einem Kameraden?“
In demselben Augenblick umarmte
Liebchen mich und rief: „So möcht ich sterben!
Komme, Tod, und raub mich, Tod, im Kusse!“
Und der Tod, von schwellend jungen Lippen
Heiß und leidenschaftlich angerufen,
Hörte seinen Namen mit Vergnügen.
Über sein geheimnisvolles Antlitz
Glitt ein Leuchten, und er schied in Minne.
– Eigentlich sind, gerade am Anfang, zu viele Umstellungen von Satzgliedern drin, und sie wirken, als wären sie nötig, um das Metrum zu erfüllen, was einem Text ziemlich schaden kann?! Gegen Ende hin wird es weniger, und der Vers gewinnt eine große Überzeugungskraft, er gelangt, wie bei Meyer oft: zu einem Gefühl von Klarheit und Unausweichlichkeit.