I.
Der erste kurz, der zweite lang:
Folgt nicht dem flinken Blitz des Donners Schütterklang?
II.
Des ersten Tun währt lang, der zweite lärmt nur kurz:
Die Luft im Darm entweicht als Furz.
I.
Der erste kurz, der zweite lang:
Folgt nicht dem flinken Blitz des Donners Schütterklang?
II.
Des ersten Tun währt lang, der zweite lärmt nur kurz:
Die Luft im Darm entweicht als Furz.
Was der Hexameter nicht will, weil er es nicht kann: unanschaulich werden. Wie aber dann zum Beispiel Maße beschreiben? Friedrich Rückert findet in einer Epistel, die den Angeschriebenen auffordert, für das schreibende „Ich“ einen als Geschenk gedachten Spiegel zu kaufen, diese Lösung:
Also, wie breit und wie lang? So lang und so breit als genug ist,
Nicht für ein Prunkgemach, ein fürstliches, sondern ein stilles
Örtchen, wo er soll hangen, um keinerlei Ort zu beneiden.
Also nur eben so lang, dass, wenn das Mädchen hineinschaut,
Unter dem zierlichen Köpfchen der Hals auch noch und des Busens
Oberste Ränder sich zeigen, die schwellenden, ohne dass drüber
Über den Spiegel hinaus entrücket werde das Häubchen.
Und desgleichen so breit nur wenigstens, dass ich zu höchster
Not, wenn ich enge genug an die Schläf‘ ihr mich schmieg‘, in dem Glase
Ihrem Gesicht zur Seite mein eigenes kann mit den dunklen
Locken sehn, wie die Wolke, die schattende, neben der Sonne.
Man kann diese elf Verse noch auf manch andere Eigenschaft hin abklopfen, und mit Gewinn; aber die art, wie Rückert hier eben nicht „40x80cm“ schreibt, ist schon für sich ein helles Licht auf das, was den Hexameter ausmacht …
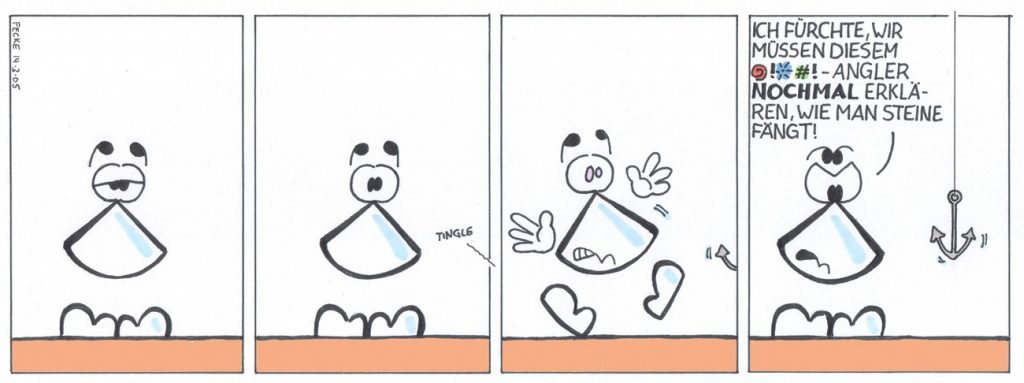
Der Regen hat der scheuen Quelle
Geduldig Mut gemacht; da hat sie sich getraut,
Sich von der angestammten Stelle
Zu lösen, und hat stolz bei mir vorbeigeschaut!
Ich stand, mit Gummistiefeln an den Füßen,
Im Flur, die Gute zu begrüßen,
Und bot ihr einen Eimer an;
Sie dankte lieb und frug,
Als ich sie aus dem Hause trug,
Ob sie mich nächstes Jahr erneut besuchen kann.
Diesmal vier streng gebaute, aber dabei gereimte Uz-Strophen von Anna Louisa Karsch, die in „An Uz“ nicht nur die Form verwendet, sondern auch den Erfinder der Strophe anredet und mit dem ersten Vers das uzsche Erstgedicht auch inhaltlich aufruft ( das beginnt „Ich will, vom Weine berauscht, die Lust der Erde besingen“), danach aber vor allem über sich redet, unter Einschluss von Hinweisen auf Ludwig Gleim (der „liebende Freund“ Uz‘ und Gegenstand der unerfüllten Liebe Karschs). „Felsenspringerin“ meint Sappho, die sich aus unerwiderter Liebe von einem Felsen gestürzt haben soll. Ein knapper Text über die Dichterin von einem Dichter, Jan Wagner: Die deutsche Sappho.
Du, der vom Weine berauscht die Lust der Erde besungen,
Mir gab Apollo kein lyrisches Spiel
Bespannt mit Saiten von Gold, doch sind mir Lieder gelungen;
Süßklingend sang ich der Seele Gefühl.
Mich hört der eiserne Held, mir horcht der ernste Gesandte
Herunter kommend vom Stuhle des Herrn,
Auch höret meinen Gesang, wer sonst die Muse verkannte,
Des Geizes Priester vernehmen ihn gern.
Mir gab dein liebender Freund der Felsenspringerin Laute,
O, ihn nur denken wird süßer Gesang
In der ganz sapphischen Brust; der Liebesgötter Vertraute
Ward ich und habe die Herzen in Zwang!
Mich fühlt der wankende Greis, die abgelebte Matrone,
Mich horcht der Jünglinge klopfendes Herz.
Das Mädchen fürchtet den Pfeil! Er rauscht im sapphischen Tone
Laut, wie im Uzischen Liede voll Scherz.
„Ich weiß, warum ihr euch um dieses Verspaar schartet!“
„Warum?“ – „Weil ihr aufs Reimwort wartet!“
Hier noch einmal zu den Jahreszeiten, die sehr gegenwärtig waren in den damaligen Texten, vier Strophen aus Johann Adolph Schlegels „Verherrlichung des Schöpfers durch seine Geschöpfe“ (insgesamt 18 Strophen lang), die auch Frühling, Sommer, Herbst und Winter zu diesen „Geschöpfen“ zählen:
Du, Frühling, besingest sein Lob aus hundertstimmigen Kehlen.
In Wäldern weckst du der Vögel Gesang,
Wenn in die erstarrte Natur dein allbelebender Odem
Aufs neu balsamisches Leben ergießt.
O Sommer, du predigest ihn. Mit Reichtum füllst du die Erde,
Und aus der Fruchtbarkeit webst du ihr Kleid.
Wer jauchzet nicht, wenn du das Land zu langem Wohltun begierig,
Und seinem Schöpfer so ähnlich gemacht?
O Herbst, du verkündigest ihn in deinen reifenden Früchten.
Was gleicht der Wohltat des stärkenden Weins?
Er scheuchet die Schwermut aus uns, und ruft die Freude zurücke;
Und Greise trinken das Leben in ihm.
Du preisest ihn, Winter, und tobst, dass nicht aus giftigen Nebeln
Der Herbst uns grimmige Würger erzeugt.
Die Saaten beschützest du selbst durch Schnee mit wärmenden Hüllen
Vor deines Frostes ertötender Wut.
Formbemerkung: In den großen Uz haben alle ersten Halbverse eine zusätzliche unbetonte Silbe, alle zweiten Vershälften nicht!
Ich denke, es ist wieder einmal an der Zeit für einige strenggebaute Uz-Strophen, zwecks Versicherung des Ur- und Schwerpunkts der Form; die folgenden fünf stammen aus Nikolaus Dietrich Gisekes „Der Herbst“. „Thompson“ ist dabei James Thompson; er hat zwischen 1726 und 1730 vier Gedichte über die Jahreszeiten geschrieben („Seasons“), die, nach ihrem Bekanntwerden in Deutschland, eine Menge ähnlicher Gedichte deutscher Verfasser angestoßen haben.
Still und gedankenvoll geht, von allen Musen begleitet,
Ein Dichter durch das sich freuende Tal,
Wie Thompson, der die Natur auf ihren Fluren besuchte,
Und ihre Reizungen alle besang.
Du fliehst den Dichter, o Herbst, und horchst auf seine Gesänge,
Auf deines Freundes begeisterndes Lied.
Sanftrauschend dankest du ihm; du rauschest durch die Gesträuche,
Du rauschest über den spielenden Bach,
Bis die entfliehende Sonn‘ und ihr noch buhlendes Auge
Sich schamhaft hinter die Büsche verbirgt:
Sie lacht noch einmal, und flieht, wie eine sittsame Schöne
Aus des Geliebten Umarmungen flieht.
Mit seiner silbernen Stirn sieht aus den Pforten des Aufgangs
Der stille Mond in die Felder herab.
Er kömmt; die Sterne mit ihm: doch keiner unter den Sternen
Ist mit der Erde vertrauter als er.
Jetzt schweigt die ganze Natur, nichts störet die heilige Stille,
Als wenn verliebt sich ein Jüngling beklagt.
Er seufzt am einsamen Bach, an melancholischen Ufern,
Wo er sich ängstende Bilder erschafft.
Ihr lasst der Freundschaft warmen Schein
Ins Herz, klar Licht ins Hirn hinein,
Und dann: Ihr werdet leuchten!
Wieder eine neue Abwandlungsmöglichkeit: Während alle bisherigen Beispiele den „großen Uz“ mit einem kürzeren Vers verbunden haben, der gleichfalls unbetont beginnt, wählt Gerhard Anton Halem als Zweitvers einen betont einsetzenden Dreiheber:
◡ —, ◡ (◡) —, ◡ ◡ — | ◡ —, ◡ (◡) —, ◡ ◡ —, ◡
— ◡ (◡), — ◡ ◡, —
Vier Verspaare aus Halems „Zuruf“:
Ihr Edle! Trocknet den Schweiß! Verfolgt mit deutschem Beharren
Eifrig die rühmliche Bahn!
Erreicht ihr – ich‘ seh‘ es im Geist, doch wird mein Aug‘ es erblicken?
Kämpfer! Erreicht ihr das Ziel,
So will ich, Deutscher auch ich, zuerst euch Sieger begrüßen.
Folgt‘ ich gleich anderer Bahn,
So will ich dennoch gerührt euch Sieger begrüßen, und rufen:
„Folgt mir zum Tempel Apolls!“
Auch das kann überzeugen. Wobei dieser Kurzvers, der „Archilochius“, schon in der Antike als Begleiter des Hexameters auftrat und diese Zusammenstellung auch um 1750 in Gebrauch war; was wieder einen Berührungspunkt zwischen „Großem Uz“ und Hexameter erhellt!