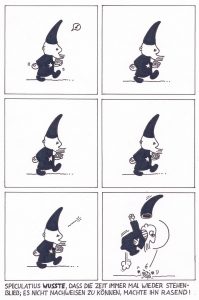Als Vergil seine „Eklogen“ schrieb, tat er dies (auch) mit dem Vorbild Theokrit vor Augen und dessen 200 Jahre älteren Idyllen (Theokrits „Rinderhirten“ sind Gegenstand von Der Hexameter (51)!). Viel, viel später nahm sich dann Johann Peter Hebel Vergils siebte Ekloge zum Vorbild in „Kürze und Länge des Lebens“, wie die beiden antiken Texte ein Wechselgesang zweier Hirten. Der Anfang:
Dumpf ertönte vom hohen Turm das Trauergeläute
und der Leichengesang erscholl zum blumigen Hügel,
wo Bathyll und Damötas, noch beide blühend dem Leben,
beide kundig des Wechselgesanges, am Abhange saßen.
Dieser schaute jenen, der diesen schweigenden Blicks an,
bis im stillen Verein, unaufgefordert vom andern,
also Bathyll begann, und also Damötas ihm folgte.
Bathyll
Kurz ist dein Leben, o Mensch. In einem Jahrhundert beginnt es,
und im nämlichen fällts. – Einst sah dort die grünende Eiche
Gustav Adolfs Heer, sieht jetzt des gallischen Cäsars
fliegende Fahnen wehn, und harrt noch auf spätes Ereignis.
Damötas
Lang ist dein Leben, o Mensch. In einem lachenden Monat
ward die Blume des Hains; der nämliche Monat begräbt sie.
Kinder des lachenden Jahrs, buntfarbige Sylphen, die Ähre
keimt schon im zarten Gras, doch seht ihr nicht mehr die Ernte.
Nach der Einleitung, die eine etwas eigenartige Mischung herstellt (die aus der Antike herrührenden Hirten unter „Trauergeläute“), singt jeder der beiden vier Verse, der eine über die Kürze, der andere über die Länge des Lebens; dann tritt Euphronos auf und spricht eine Art Schlusswort (selbstverständlich ein vierversiges):
Also sangen die Freunde. Es rauscht in dem nahen Gebüsche.
Aus dem Gebüsche trat mit heiteren Blicken Euphronos.
Lieblich, wie das Wiegen der Wipfel im Hauche des Zephyrs,
war mir euer Gesang. Ja kurz, ja lang ist das Leben.
Söhne, genießet es nur! o Söhne, nützet es weise!
Der hat lange gelebt, der froh und weise gelebt hat.
– Und das ist dann in seiner Lehrhaftigkeit, seinem Belehrenwollen in der Unterhaltung doch sehr deutlich Hebel, und eben nicht mehr Theokrit oder Vergil?! Jedenfalls eine bedenkenswerte Möglichkeit, Texte, die durch viele Jahrhunderte hindurch ihre Wirkung hatten, für die eigene Zeit nutzbar zu machen … Hebels Hexameter ist dabei sicher und formbewusst; viel zahlreicher als seine hochdeutschen sind aber seine Dialekt-Hexameter, wie sie sich in den „alemannischen Gedichten“ finden!