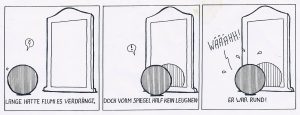„Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Eine wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein, aufgeschrieben von Ludwig Achim von Arnim“, oder kurz: „Gräfin Dolores“ ist ein Roman, den man heute nicht mehr unbedingt kennen muss, der aber eine große Menge von eigestreuten Verspassagen enthält und von daher zumindest einem Verserzähler durchaus einen Blick wert ist!
Die dabei verwendeten Versarten sind zahlreich; die recht umfangreiche „Geschichte des Mohrenjungen“ zum Beispiel ist in ungereimten trochäischen Vierhebern geschrieben. Ein Teil dieser Geschichte ist ein Brief, „Die Äbtissin an den Herzog“:
Bruder, Du hast mich verschlossen
In dem alten Fräuleinstifte,
Um die Ausstattung zu sparen,
Samt und Hafer, und das Weißbrot,
Von den Ständen mir geschenket.
Sieh, zur Strafe von dem Himmel
Bist Du ohne Kind geblieben,
Das er mir zur Straf‘ bescheret;
Doch es stammt von einem Helden,
Also wird’s ein Held auch werden,
Darum seid geneigt dem Rate,
Den ich Euch in Demut gebe.
Euer Reich fällt heim den Fremden,
Und mein armes Kind muss sterben,
Und ich geh‘ in Schand‘ verloren,
Wenn Ihr diesem Rat nicht folget,
Nicht mein Kind, in Schuld empfangen,
Mild zu Eurem Kind annehmet.
Eure Frau, die Herzoginne,
Muss sich stellen guter Hoffnung,
Und ich komme dann im Schlosse
Heimlich nieder: Gott wird helfen!
Und mein Kindlein wird getragen
Heimlich zu der Herzoginne,
Als ob sie es hätt‘ geboren.
Denkt darüber nach in Liebe,
Und dann seid Ihr überzeuget,
Fühlet recht den Willen Gottes,
Wie er Böses gut hier mache,
So verzeihet der Äbtissin.
– Das fasst die zuvorige Handlung in etwa zusammen; die Äbtissin hat sich eines Nachts jemandem im Garten hingegeben, von dem sie annahm, es wäre ein ihr seit Jugendtagen vertrauter Offizier gewesen. Der war es aber nicht, wie sich zeigt – der vorgeschlagene Plan wird umgesetzt, und:
Endlich seht das große Zeichen
In den tiefen nächt’gen Stunden,
Und der Marschall mit dem Schnupftuch
Winket zweimal aus dem Fenster,
Von den Fackeln wohlbeleuchtet.
Also ist ein Prinz geboren,
Und die Kanoniere schießen,
Dass die Scheiben aus den Fenstern,
Menschen aus den Türen fliegen;
Und es gibt ein frohes Jauchzen,
Dass die Frösche in dem Teiche
Nicht alleine nächtlich singen.
Als das Wappen eingebrennet
Unserm Prinzen an den Hüften,
Dass man ihn nicht mög‘ vertauschen,
Merkt man eine eigne Farbe
In der Haut, die schwer zu nennen;
Doch das ist gar oft an Kindern,
Die erst neu zur Welt gekommen,
Eins ist grün, das andre bläulich,
Das vergeht in wenig Wochen.
Als die Glückwünschung empfangen,
Und die Taufe ist verrichtet,
Und noch vierzehn Tage später
Dauert unsers Herzogs Freude.
Doch da wird der Prinz viel schwärzer
Als des Herzogs Tintenfinger,
Den er braucht zum Unterzeichnen,
Und der Herzog sieht mit Schrecken,
Dass es sei ein Mohrenjunge,
Was noch keiner von den Ärzten
Hat gewagt, ihm zu verkünden.
Und der Herzog will verzweifeln,
Beißet sich auf seinen Finger
Und der schmecket gar nach Tinte;
Und die Herzogin erboßet,
Dass ihr guter Ruf könnt leiden,
Wütet ein auf die Prinzessin, –
Doch es muss verheimlicht werden.
Traurend wird des Thrones Erbe
Bei dem Volke tot gesaget,
Und ein Affe wird geschlachtet
Von den beiden flinken Ärzten,
Wohlrasiert und angezogen,
Mit dem Myrtenkranz und Degen,
In ein kleines Sarg geleget,
Schwach beleuchtet ausgestellet,
Und mit großem Leichenzuge
Beigesetzt in der Kapelle.
Die ganze Geschichte hat einen etwas unernsten und bisweilen mutwilligen Tonfall, in dieser Hinsicht Karl Immermanns vor einigen Tagen unter (55) erwähnten „Tulifäntchen“ durchaus vergleichbar; allerdings hat Immermann im Vergleich zu Arnim die besseren Verse geschrieben!
Arnims Vierheber wirken auf mich nicht mühlelos, sondern eher so, als hätte er auf das Schreiben keine Mühe verwendet. Der Vers tritt gegenüber dem Satz stark zurück, und da, wo sein Einfluss hörbar wird, ist es oft zum Schlechten, etwa, wenn nicht nur vor einem Vokal, sondern auch vor einem Konsonanten ein schwaches „e“ abgeworfen wird: „Straf‘ bescheret“, „mögt‘ vertauschet“. Derlei ist in Reimversen häufiger zu hören und gefällt mir auch da schon nicht recht, ist aber in ungereimten „Bewegungsversen“ noch deutlich unangenehmer!?
Andererseits bekommt der Text gerade so den mutwilligen, eigenen Ton; und man darf auch nicht vergessen, dass diese Geschichte bei aller Länge innerhalb eines umfangreichen Prosatextes steht.
Also, lesbar sind diese Vierheber auch in der Menge allemal, und auch die Geschichte geht, ganz am Ende, gut aus, als es vom Herzog („er“) und vom Mohrenjungen heißt:
Klüglich nimmt er an den Jungen,
Sich zum Hof- und Staatspropheten,
Dass er ihm die Krone halte.