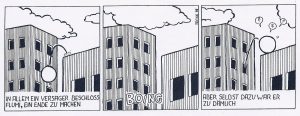Detlev von Liliencrons „Der Ländler“ erzählt sehr entspannt, in einem Blankvers, der die Sprache wirklich kaum merkbar formt:
Auf die Terrasse war ich hinbefohlen,
Der jugendlichen, schönen, geistvollen,
Holdseligen Prinzessin vorzulesen.
Ich wählte Tasso.
Durch den Sommerabend
Umschwirrt uns schon das erste Nachtinsekt.
Die Sonne war gesunken. Rot Gewölk
Stand hellgetönt, mit Blau vermischt, im Westen.
Der Garten vor uns, tief gelegen, hüllt
Sich ein in dunkle Schatten mehr und mehr.
Und eine Nachtigall beginnt.
Der Diener
Setzt auf den Tisch die Lampen, deren Licht
Nicht durch den schwächsten Zug ins Flackern kommt.
Von unten, aus dem Dorfe, klingt Musik,
Und deutlich aus der Finsternis heraus,
Leuchtstriche, blitzen eines Tanzsaals Fenster.
Die Paare huschen schnell vorbei in ihnen.
Zuweilen, wenn die Tür geöffnet steht,
Erschallt Gestampf, der Brummbaß, Kreischen, Jauchzen.
Unbändig scheint die Freude dort zu herrschen.
Ich trage unterdessen weiter vor,
Wie flüchtige Bilder, unbewußt, den Trubel
Im Tal an mir vorüberziehen lassend,
Und jene Verse hab ich grad‘ getroffen:
„Beschränkt der Rand des Bechers einen Wein,
Der schäumend wallt und brausend überquillt?“,
Als ich die Lider hob und die Prinzess,
Die säumig ihre Linke dem Geländer
Hinüber ruhen lässt, erblicke, wie sie,
Nicht meiner Lesung achtend, niederschaut,
Das braune Auge träumerisch, sehnsüchtig
Hinuntersendet auf den fröhlichen Ländler.
„Wie wär‘ es, fänden wohl Durchlaucht Vergnügen,
Dem frohen Reigen dort sich anzuschließen?“
Und sie, ein Seufzer: „Ach, ich tät’s so gern.“
Wenn ich’s nur bringen könnte, wiedergeben,
Wie jenes Wort von ihr gesprochen ward,
Das „so“, das „gern“, wenn ich’s nur treffen könnte,
Wie sie das sagte: „Ach, ich tät’s so gern.“
Ob nun der in Blankversen geschriebene „Tasso“ dem „Ländler“ dieses Versmaß eingebracht hat, oder umgekehrt der in Blankversen geschriebene „Ländler“ „Tasso“ (und nachfolgend das passende Zitat daraus) als vorgetragenen Text herbeirief – wer weiß es; die Trennung eines Blankverses auf zwei Abschnitte eines erzählenden Gedichts, wie hier zweimal zu beobachten, ist aber auf jeden Fall seltener als die Aufteilung eines Blankverses auf zwei Sprecher im Drama!