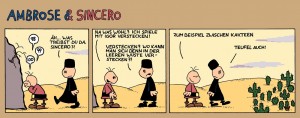In der 2003 bei Pelican erschienenen und von Lewis B. Semple herausgegebenen Ausgabe von H. W. Longfellows „Evangeline“ wird im Abschnitt „Introduction“ auch das verwendete Versmaß erklärt; auf durchaus ansprechende und nachvollziehbare Art, weswegen ich diese Erkärung des Hexameters hier, im Text leicht und in den Beispielen stark gekürzt, vorstellen möchte (sie findet sich auf den Seiten xlvii – li) – ein Blick aus einem leicht anderen Winkel ist immer hilfreich!
„The metre in which ‚Evangeline‘ is written is called dactylic hexameter. Each verse contains six feet (hence the name hexameter). In the normal verse each foot except the last consists of an accented followed by two unaccented syllables (dactyl). The last foot has one accented and one unaccented syllable (trochee).
This is the / forest pri- / meval. The / murmuring / pines and the / hemlocks
As a succession of perfectly regular verses would prove monotonous, substitutions are frequently made, usually a trochee for a daktyl.
Waste are those / pleasant / farms, and the / farmers for- / ever de- / parted.
A trochee is not often found in the fifth foot. Frequently a verse contains more than one substituted foot:
Stand like / harpers / hoar, with / bears that / rest on their / bosoms.
Monotony is further relieved by varying the position of the pauses. Obviously, pauses must be made in so long a verse, and their occurence in any fixed place would give the reader an unpleasant jolt. The rhythmical pause may or may not be indicated by puctation.
There dis- / order pre- / vailed, || and the / tumult and / stir of em- / barking.
It will be noticed that the linking of verses together has much to do with oral reading. Verse structure and sentence structure may correspond: In such a case the sentence is usually a topic sentence. But as a rule the sentence is carried on from one verse to another, and this necessitates pauses of varying length at the end of the lines.“
Das liest sich doch sehr hilfreich?! Darüber, dass eine der „Pausen“, die in der Versmitte, etwas wichtiger ist als die restlichen, hätte man noch ein Wort verlieren können, aber gut: muss man nicht. Erst recht nicht angesichts der nächsten Sätze:
„The scansion of the line offers few difficulties. In general, a safe rule to follow is, accent the first syllable and the rest will take care of itself.“
So einfach ist das also … Entweder ist das Englische doch geeigneter für Hexameter, als immer gedacht; oder Longfellow war ein Verskünstler erster Güte. Vielleicht auch beides!