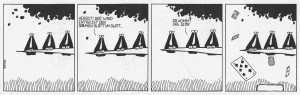Sehen Sie, die Nacht ist dunkel,
Sagt der Grottenolm und kratzt sich
Dünnen Arms den augenlosen
Schädel, und der Tag desgleichen.
Sagt’s; und wedelt mit den Händen,
Wenigfingrig, die Besucher
Seiner Höhle zu verweisen.
Mit Versen erzählen!? (6)
Hat man die – in (5) vorgestellten – Spittlerschen Begriffe „Verstandeslogik“ und „Bildlogik“ erst einmal zur Kenntnis genommen samt ihrer Bedeutung für das Erzählen, fangen sie schnell an, ein Eigenleben zu führen und sich an alle möglichen anderen Inhalte anzuschließen. Zum Beispiel an den Anfang eines Briefes, den Schiller Ende 1797 an Goethe geschrieben hat, eben zu der Zeit, als er die Prosafassung seines „Wallenstein“ in Blankverse umgeschrieben hat:
Ich habe noch nie so augenscheinlich mich überzeugt, als bei meinem jetzigen Geschäft, wie genau in der Poesie Stoff und Form, selbst äußere, zusammenhängen. Seitdem ich meine prosaische Sprache in eine poetisch-rhythmische verwandle, befinde ich mich unter einer ganz andern Gerichtsbarkeit als vorher; selbst viele Motive, die in der prosaischen Ausführung recht gut am Platz zu stehen schienen, kann ich jetzt nicht mehr brauchen; sie waren bloß gut für den gewöhnlichen Hausverstand, dessen Organ die Prosa zu sein scheint; aber der Vers fordert schlechterdings Beziehungen auf die Einbildungskraft, und so musste ich auch in mehreren meiner Motive poetischer werden.
Eine „ganz andere Gerichtsbarkeit“ also, und „Beziehungen auf die Einbildungskraft“, die „der Vers fordert“: Das ist von Spittelers Anmerkungen gar nicht so sehr weit weg?!
Erzählverse: Der Blankvers (67)
Christian Friedrich Scherenberg erlangte einige Bekanntheit mit Epen über die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens noch nicht allzu ferne napoleonische Zeit: „Waterloo“ (1849), oder auch „Abukir. Die Schlacht am Nil“ (1855). Daraus einige Verse, die zeigen, wie sich denn der Blankvers auf See bewährt; bei den Vorbereitungen auf die Schlacht, genaugenommen …
Noch einmal überschaut von seiner Höhe
Der Admiral den Halbmond seiner Flotte,
Des Hörnerspitzen fern im Dunst zerflossen.
Dann hob er wieder den gesenkten Stab,
Und winkte: „Fertig zur Aktion!“ Und rauschend,
Wie wenn das Drama auf den engen Brettern
Beginnen soll, der Vorhang aufrollt, rollt
Herab die Segelwand, und schwirrend, wie
Am Webstuhl, fliegt von Hand zu Hand die Arbeit
Auf knappem, straff umsponnenen Verdeck:
Gerefft wird, was losbändig, ausgehändet
Das Pulver, das Geschütz geladen, los
Gemacht die Taljen, durchgeholt das Stück,
Geöffnet sind die Luken, die Lunte brennt,
Der Stückmatrose tritt an seine Kanone,
Der Arzt legt aus sein Wundzeug – still ist alles.
Aber nicht lange … Na, worauf es ankommt: Ich finde, das kann man lesen (die Probe ist, wie immer, der eigene, laut gesprochene Vortrag), mitsamt der manchmal heftigen Zeilensprünge und der nicht immer klaren Wechsel zwischen den Zeiten. Die Verse werden als Verse erfahren; das allein zählt!
Erzählverse: Der Hexameter (113)
Rudolf Hamerling hat sich über die Form seines langen „Schwanenlieds der Romantik“ viele Gedanken gemacht. Entscheiden hat er sich am Ende für die Nibelungenstrophe, aber er hat zuvor auch einige Bruchstücke in Kanzonenform verfasst; und auch einige Teile in Hexametern! Von diesen stelle ich hier einen vor.
Aber am schönsten erglänzt, auf des nächtlichen Himmels azurnem
Grunde gemalt, San Marco, die schimmernde Goldarabeske,
Dämmrig zart, wie gehaucht, und doch so golden und farbig-
Hell, so ruhig und groß; schwerwuchtig auf mächtigen Quadern
Thronend und doch auch wieder so leicht, schwungkräftig und strebend,
Gleich als wär‘ eine Gondel der Dom, die, golden beflittert,
Wartet des Festaufzugs – prunkvoll, gleichschwebend und sicher
Rastend auf ruhiger Flut, doch bereit, pfeilschnell zu entgleiten;
Oder ein riesiger Vogel mit goldnem Gefieder, ein Phönix,
Der, aus ätherischen Höhen herab sich senkend, den Boden
Eben nur streift und schon wieder mit flammenden Fittichen aufstrebt.
– Da fällt so manches auf?! Die beiden heftigen Zeilensprünge gleich am Anfang, im ersten und im dritten Vers, zum Beispiel; aber vor allem die „geschleiften Spondeen“. Hier …
Hell, so / ruhig und / groß; || schwer- / wuchtig auf / mächtigen / Quadern
… passt es noch wirklich gut zum Inhalt, und auch das „schwungkräftig“ mag noch angehen; aber dieser Vers …
Wartet des / Festauf- / zugs || – prunk- / voll, gleich- / schwebend und / sicher
— v v / — — / — || — / — — / — v v / — v
… zeigt ganz gut, warum man mit diesem – auf jeden Fall zum Hexameter gehörenden! – Darstellungsmittel besser vorsichtig umgeht. Sicher, das „Prunkvolle“, Ungewöhnliche wird bekommt so Gestalt; aber der Vortragende muss sich doch sehr abmühen, um der Bewegungslinie Glaubhaftigkeit zu verleihen.
Dafür sind die letzten drei Verse sehr schön geworden und lassen ein klein wenig Bedauern aufkommen, dass am Ende doch nicht das ganze Werk in diesem Maß geschrieben worden ist!
Go: Die alten Meister (32)
Des alten Meisters Stein,
Mit Schwung gesetzt, voll tönt’s!
Tut kund: Der Sieg ist mein.
Erzählformen: Die Brunnen-Strophe (9)
„Brunnen-Strophe“, ich erwähnte es schon, ist ein Verlegenheits-Begriff; bei irgendeinem Namen muss diese Strophe ja genannt werden! Als ich heute kurz in Conrad Beyers „Deutsche Poetik“ schaute, stellte ich fest, dass er diese Aufgabe, nun, rustikaler gelöst hat: Da die Strophe leicht zu handhaben sei und daher von dilettierenden Dichtern sehr geschätzt werde, nannte Beyer sie einfach eine Dilettanten-Strophe. Tja … Nicht nett, aber wahrscheinlich zutreffend. Das folgende Werklein, „Liebe“, stammt von Victor Ludwig Eduard von Cambecq:
Die Lieb‘ ist eine Blume,
Im Paradies erblüht –
Ein lichter Traum, der wonnig
Das Menschenherz durchglüht.
Die Lieb‘ ist ein Gedanke
Der Gottheit, groß und schön –
Und wer ihn denkt, kann mutig
Dem Tod ins Auge seh’n.
Das ist, vielleicht: ein ganz gutes Beispiel für ein dilettierendes Gedicht. Sein Verfasser war mir gänzlich unbekannt, aber heutzutage gibt es ja nichts, was das Netz nicht weiß; und so erfuhr ich dann aus Franz Brümmers 1913 erschienenem „Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart“:
Cambecq, Victor Ludwig Eduard von, * 1833 in Dorpat, kam in seinem dritten Lebensjahre nach Kasan, wohin sein Vater als Professor des römischen Rechts für die dortige Universität versetzt worden war. In Kasan empfing der Sohn seine Bildung; er widmete sich naturwissenschaftlichen, historischen und besonders philologischen Studien, starb aber schon 1854, kurz vor Abschluss derselben.
Hm. Ein Leben von nur 21 Jahren … Da blieb dann auch nicht viel Zeit, aus dem Dilettanten-Dasein herauszuwachsen; und die Sache mit „Dem Tod ins Auge seh’n“ bekommt so einen etwas anderen Klang?!
Ohne Titel
Dass es nichts als Mühe machte,
Und: „Ich kann doch nur gewinnen,
Scheide ich schon früh von hinnen“,
Sah am Ende seiner Zeiten
Seinen Tod die Arme breiten,
Dahinein er folgsam lief,
Langsam auch; pejorativ
Schien der Tod mit einem Mal –
Und dann war’s auch schon egal.
Mit Versen erzählen!? (5)
Verserzählungen werden heutzutage nicht geschrieben, und würden sie geschrieben, läse sie niemand; Romane dagegen werden in unüberschaubaren Mengen von Schreibern geschrieben und von Lesern gelesen.
Da macht es Sinn, die beiden Gattungen einmal nebeneinander zu halten!? Carl Spitteler schreibt in seinem kleinen Aufsatz „Das Kriterium der epischen Veranlagung“:
Als Kennzeichen der epischen Veranlagung gelten mir: die Herzenslust an der Fülle des Geschehens, seien es nun Taten oder Ereignisse, die Freude am farbigen Reichtum der Welt, und zwar, wohlgemerkt, Reichtum der äußeren Erscheinungen, die Sehnsucht nach fernen Horizonten, das durstige Bedürfnis nach Höhenluft, weit über den Alltagsboden, ja über die Wirklichkeitsgrenzen und Vernunftschranken.
Und wenig später:
Zur Kontrolle von der Gegenseite her dient mir als sicheres Kennzeichen des Nichtepikers: die Lust an der Charakteristik, an der Seelenanalyse – also an psychologischen Problemen -, an der wohlmotivierten logisch-vernünftigen Erzählung.
Das ist nichts für einen Epiker,
weil es ja das oberste Gesetz epischer Kunst ist, Seelenzustände in Erscheinung umzusetzen. Umständliche seelische Motivierung, von innen heraus geschildert, würde also jedesmal in einem epischen Gedichte einen Fehler bedeuten.
Demnach ist das, was ein Nichtepiker – also für gewöhnlich ein Romanerzähler – betreibt,
nicht etwas ähnliches auf anderer Stufe, nein, es ist das schnurgerade Gegenteil in allem und jedem.
Ich glaube, da ist etwas dran …
Wie aber fügt sich der Vers hier ein?! Das legt Spitteler in einem anderen Text dar, „Über die tiefere Bedeutung von Vers und Reim“. Darin ordnet er der Prosa die „Verstandeslogik“ zu, der lyrischen Dichtung die „Gefühlslogik“, der epischen Dichtung aber die „Phantasielogik“ oder auch „Bildlogik“; und erklärt, zum Gelingen eines Textes sei es nötig, dass der Leser ihn im Rahmen der dazugehörigen Logik wahrnimmt!
Der Rhythmus stimmt die Seele des Hörers anders, als sie im gewöhnlichen Alltagsleben gestimmt ist, denn in dem spricht man Prosa; der Rhythmus weckt Bedürfnisse, die unter den gewöhnlichen Umständen schlummern, rückt Dinge, die im Hintergrund der Seele ruhten, an den ersten Platz und beseitigt dafür andere, die im täglichen Leben das große Wort führen. Die Seele des Hörers erwartet und begehrt einen anderen Inhalt von der rhythmischen Rede als von der prosaischen Rede und ist gewillt, gewissen Ansprüchen, die sie an die prosaische Rede oder Erzählung stellt, zu entsagen.
Und etwas weiter:
Wenn ich eine epische Poesie ohne starkschwingenden Rhythmus und ohne Vers und Reim bringen wolle, so würde ich unter die Herrschaft der nüchternen Verstandeslogik zu stehen kommen; der Hörer würde den Mangel einer Einleitung, einer genauen Situationsbeschreibung, die Unterlassung der Charakterschilderung als Lücken, die Gedankensprünge als Stöße und beides als Fehler empfinden. Auch hier erzeugen Rhythmus, Metrum und Reim andere Seelenstimmung, andere Wünsche und dadurch die Herrschaft einer anderen, höheren Logik.
Das steht nun auf wackligeren Füßen, finde ich; aber ein nachdenkenswerter Gedanke ist es allemal!
Ohne Titel
Schreiben ist Suchen, der Vers, der sich reibt, Licht leuchtet: ein Streichholz