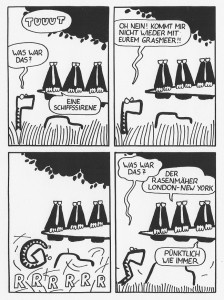Joachim Ringelnatz‘ „Träumerei“ ist ein doppelt bemerkenswertes Gedicht: Einmal, weil es zu Werbezwecken geschrieben wurde, wie sein, nun ja, Untertitel verrät: „Reklamegedicht für die Orientalische Tabak- & Zigarettenfabrik Yenidze, März 1908“. Zum anderen wegen des gewählten Versmaßes – der Hexameter ist zwar erkennbar Grundlage, aber längst nicht immer verwirklicht! Die ersten Verse:
Klopfte es nicht? – Wahrhaftig, die Tür wird geöffnet …
Vor mir mit Turban und wallendem Mantel stand Harun al Raschid.
Seinem Winke gehorchend, folgte ich klopfenden Herzens.
Schweigend eilten wir zwei durch fremde, verdunkelte Gänge,
Bis uns auf einmal am Tor strahlende Helle umfing.
Dort unter himmlischer Bläue vor meinem staunenden Auge
Schäumte, rauschte, glitzerte tausendfältig
Wie mit Smaragden besäet – das unermessliche Meer.
Ein buntes Durcheinander?! Nimmt man den Hexameter als Maßstab, ist der erste Vers einen Fuß zu kurz, der zweite zwar sechsfüßig, aber seltsam ungeformt. Der dritte Vers hat eine falsche Zäsur, dann folgt aber nicht nur ein formvollendeter Hexameter im vierten Vers, sondern auch noch ein lupenreiner Pentamter im fünften, so dass urplötzlich ein Distichon erklingt! Dann wieder ein guter Hexameter im sechsten Vers, ehe ein fünffüßiger Vers und ein um die Schlusssilbe verkürzter Hexameter diesen Abschnitt beschließen.
So, vom Hexameter her gehört, eine ganz eigene Erfahrung und, denke ich mal, von Ringelnatz auch so gewollt?! Er hätte ja ohne große Schwierigkeiten „regelrechte“ Hexameter schreiben können –
Klopfte es nicht? – Wahrhaftig, die Tür wird geöffnet, und vor mir
Stand, mit Turban und wallendem Mantel: Harun al Raschid.
Hat er aber nicht! (Warum sich die Gegenwartsform „wird geöffnet“ eingeschlichen hat, ist allerdings unklar.)
Werbender war Ringelnatz aber aus Überzeugung, immerhin: „Die Zigaretten sind wunderbar“, merkt er an anderer Stelle an in Bezug auf das beworbene Produkt.