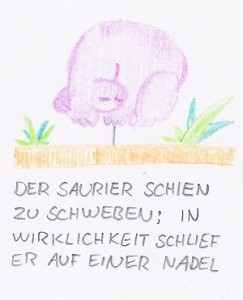Worte krümeln aus der Hand mir,
Doch! Wie trocken Brot, zerrieben,
Nicht wie Sand und nicht wie Wasser
Rieselt aus der Hand und rinnt –
Worte krümeln aus der Hand, ihr
Tauben, hört ihr’s? Seht ihr’s? Kommt!
Erzählformen: Die alkäische Strophe (17)
Zu Friedrich Gottlieb Klopstock gehört auf mehr als eine Weise der Begriff „Erhabenheit“. Viele seiner Texte beruhen auf ihm, auch viele seiner Oden, alkäischer oder anderer Art. In „Unterricht“ driftet diese Erhabenheit allerdings ins Komische ab – es geht dabei um das Zureiten einer Stute!
Iduna Hensler grüßet, mein Stolberg, dich,
Und sagt dir leichthinspielendes Ganges, hoch
Den Kopf, die Mähn‘ im Fluge: Dass sie,
Bei der entscheuchenden Kerze Schimmer,
In diesem stets noch starrenden Winter, (Ach
Zum ersten Male wagt‘ ich, die mürrischen
Ostwinde meidend, nicht, der Eisbahn
Tönende Flügel mir anzulegen!)
Durch mich zum Aufsitz stehen gelernt; durch mich
Gelernet kurzen Zephyrgalopp, verlernt,
Doch nicht zu sehr! den allzu frohen,
Launigen Schwung in die Läng‘ und Breite!
– Das sind die ersten drei der insgesamt sechs Strophen. Die Erhabenheit von Sprache und Form ist hör- und spürbar; der Inhalt hält sich aber so gar nicht daran, und diese Unverhältnis ist tatsächlich komisch?! Aber wie auch immer: Die Art, wie Klopstock hier die Sätze durch die Strophen führt, ist schon etwas besonderes, und da ein Auge und vor allem ein Ohr drauf zu haben, lohnt in jedem Fall.
Erzählverse: Der Hexameter (105)
Die kleinste im Vers vorkommende Sinneinheit besteht aus einer einzelnen schweren Silbe. Klopstock sagte statt „Sinneinheit“ „Wortfuß“ und schrieb über den einsilbigen Fuß (sein Beispiel war „Wut“, —):
Er gibt dem Wort, woraus er besteht, besonders wenn er gut gestellt ist, viel Bedeutung: zugleich erregt er, welches hier das Wichtigste ist, die Aufmerksamkeit dadurch nicht wenig, dass er, wenn ich so sagen darf, den Heerzug der mannigfaltigen metrischen Bewegungen Halt machen lässt.
Mir fällt, bezogen auf den Hexameter, als Beispiel ein Vers aus der Ilias-Übersetzung von Johann Heinrich Voss ein (10,482):
Sprach’s; doch jenen beseelte mit Mut Zeus‘ Tochter Athene.
Teilt man den Vers nach Sinneinheiten ab, sieht er so aus:
— / v — v v — v / v — / — — v / v — v
– Wobei „Sprach’s“ der einsilbige Wortfuß wäre. Eine Silbe, die von ihrem Wesen her auch sehr gut einen eigenen Wortfuß bilden kann: Sie ist Sinnsilbe, hat einen langen Selbstlaut und ist mit Mitlauten reich gesegnet! Ob das Wort allerdings durch seine Rolle als Wortfuß „viel Bedeutung“ hat, scheint fraglich; dafür ist es doch zu sehr ständig wiederkehrende Formel.
In Eduard Mörikes „Märchen vom sichern Mann“ lauten die Verse 18 und 19 so:
Laut im Gespräch mit sich selbst, und oft ingrimmigen Herzens
Weg- und Meilenzeiger mit einem gemessenen Tritt knickt
– Vers 18, wieder die Gliederung nach Wortfüßen:
— / v v — / v v — / v — / — — v v — v
Auch hier ein einsilbiger Wortfuß zu Versbeginn, der hier dann wirklich das laut heraushebt?! Außerdem dient er als „Umschalter“, hinter ihm wechselt der Vers in eine steigende Bewegung (was er sonst meist erst nach der Zäsur macht), gut zu hören an den drei steigenden Wortfüßen, die auf den Einsilber folgen!
Ob bei V19 auch ein Einsilber am Anfang steht? Eher nicht. Aber da lohnt der Blick ans Versende. Die Frage, ob dort als letzte Silbe überhaupt ein Einsilber stehen darf, wurde von den Theoretikern des Verses unterschiedlich beantwortet. Wenn er stehen darf, hat er oft auch einige Wirkung:
— v — v — v / v — v / v — v v — / —
– Es ist nicht leicht, hier Sinn-, und das meint ja auch: Sprecheinheiten abzuteilen?! Aber außer Frage steht, die letzte Silbe hat eine deutliche Wirkung; sie wird herausgehoben und als besonders gekennzeichnet!
Hier könnten jetzt noch weitere Beispiele folgen; es gibt ihrer überreichlich. Sie zeigten aber auch nur, was aus diesen drei Versen schon deutlich wird: Klopstock hatte Recht mit seiner Aussage, und wer selbst Hexameter schreibt, kann den eigenen Versen einige Schärfe verleihen, setzt er diese einsilbigen Wortfüße bewusst ein!
Go: Die alten Meister (28)
Die alten Meister sagen:
Wer schnelle Siege will,
Muss scharfe Züge wagen.
Im Hinterzimmer
Im Hinterzimmer des Verserzählers hat sich eine weitere Abhandlung metrischen Inhalts eingefunden:
Über die Regeln des deutschen Jamben, geschrieben von August Wilhelm Schlegel.
Das liest sich nicht unbedingt leicht – es ist schon älter, die benutzten Fachwörter sind nicht immer geläufig, und es geht sehr in die Einzelheiten. Trotzdem wird jeder, der sich für metrische Fragen erwärmen kann, so dies oder das finden, worüber nachzudenken sich lohnt … Ich setzte hier nur einen kleinen Ausschnitt über den „Spondeus“ hin, einen antiken Versfuß aus zwei langen Silben, über den viel gestritten worden ist: Gibt es ihn überhaupt im Deutschen? Wenn ja, in welcher Form?! Schlegel schreibt dazu unter anderem:
Die gleich gewogenen Spondeen entstehen bei uns meisten nur aus Zusammenstellungen zweier einsilbiger Hauptworte; zum Beispiel der Strom braust, v — —. Die Längen müssen so lang als möglich sein, wegen der gegenseitigen Wirkung der Silben aufeinander. Jede Länge misst sich gleichsam an der, die bei ihr steht; und wenn sie der anderen nur die geringste Schwäche anmerkt, wird sie gewiss ihren Vorrang geltend machen. Die Längen müssen einander also durchaus nichts anhaben können. Darum ist dieser Spondeus ein so sehr starker Fuß: zwischen seinen Bestandteilen ist immer eine Art von Kampf.
Das Königreich von Sede (72)
Prinzessin Sofarosa schläft im Schatten hoher Bäume,
Verschläft den heißen Sommertag: erst als die Sonne fort ist,
Erst als vom Tintenfässchen sich der Zecher frohe Stimmen
Zu ihr verirren, wacht sie auf und gähnt, und reckt und streckt sich;
Sie nimmt vom Käse, nippt am Wein, sie schnürt die Wanderschuhe
Und bricht zu ihrer Reise auf – den Königsweg hinunter,
Am Schloss vorbei, man sieht sie nicht; und weiter in die Nacht.
Erzählformen: Das Madrigal (19)
Madrigale haben oft eine leichte, tändelnd-verspielte Note; aber nicht alle madrigalisch aufgebauten Texte klingen derartig! Josef Weinhebers Texte ruhen meist mehr als sie sich bewegen, ein Beispiel dafür ist „Die Badende“, die sich im zweiten Band seiner „Sämtlichen Werke“, erschienen 1954 bei Müller, auf Seite 78 findet:
Das Wasser wartete schon grau
der Nacht entgegen. Alles schwieg.
Jedoch im matten Himmelsblau
stand einer Wolke klarer Sieg,
durchsichtig Fleisch und helles Blut:
Wie eine Königin.
Ein Beben ging die Weiden hin,
ganz leis.
Die wunderbare Wolke stieg
in ihrem Abglanz, gliederweiß,
unirdisch, in die Flut.
Eindeutig madrigalisch gebaut – freie Anordnung der Reime (allerdings fehlen Waisen), unterschiedliche Verslängen! Trotzdem ein langsamer, getragener, ruhiger Text, was ja durchaus zum Inhalt passt. Zu dieser Schwere tragen sicher auch die ausschließlich betonten Versschlüsse bei.
Erzählverse: Der iambische Siebenheber (1)
Iambische Verse hat der Verserzähler schon einige „im Programm“: Den iambischen Vierheber, den Blankvers (fünfhebig) und den iambischen Trimeter (sechshebig), alle ungereimt; dazu kommen die gereimten iambischen Vierheber des Reimpaars.
Als nächstes in der Liste müsste der ungereimte iambische Siebenheber folgen, und tut es auch! Das ist allerdings ein recht seltener Vers, der so aussieht:
x X / x X / x X / x X || x X / x X / x X
Ein Langvers, der einen Einschnitt braucht, eine Zäsur! Diese ist fest und erfolgt ausnahmslos nach der achten Silbe. Diese Art von Siebenhebern ist oft gereimt, wodurch das Versende gekennzeichnet wird. Endet der Vers dagegen auf eine überzählige unbetonte Silbe, sieht er so aus:
x X / x X / x X / x X || x X / x X / x X / x
– Nur eine unbetonte Silbe mehr, aber für die Versbewegung ist sie von großer Bedeutung! Nun treffen an Versende und Versanfang zwei unbetonte Silben aufeinander, der Übergang von einem in den nächsten Vers wird auch ohne Reim für das Ohr erfahrbar.
Unter Emanuel Geibels „Jugendliedern“ finden sich auch einige „Neugriechische Volkslieder“, und zu diesen zählt „Das Kraut Vergessenheit“:
Es hat die Mutter mir gesagt, dort hinter jenem Berge,
Der Wolken um den Gipfel hat und Nebel um die Wurzel,
Dort wächst das Kraut Vergessenheit, dort wächst es in den Schluchten.
O wüsst‘ ich nur den Pfad dahin, drei Tage wollt‘ ich wandern
Und wollte brechen von dem Kraut und wollt’s im Weine trinken,
Damit ich dich vergessen könnt‘ und deine falschen Schwüre
Und deine Augen, die so oft von Liebe mir gesprochen,
Und deinen süßen, süßen Mund, der tausendmal mich küsste!
Keine große Dichtung, aber wie von Geibel gewohnt: Sichere Verse, die den Grundaufbau und die Grundbewegung des jeweiligen Maßes gut erkennen lassen!
Erzählverse: Der Hexameter (104)
Im zweiten Gesang von Goethes „Hermann und Dorothea“ findet sich dieser berühmt gewordene und viel besprochene Vers:
Ungerecht bleiben die Männer, und die Zeiten der Liebe vergehen
Berühmt geworden ist er aber nicht wegen seines Inhalts, sondern aufgrund seines fehlerhaften Baus. Der blieb nicht unentdeckt, aber als Goethe auf eine zusätzliche betonte Silbe angesprochen wurde, entgegnete er lachend: „Die siebenfüßige Bestie möge als Wahrzeichen stehenbleiben!“
Da stellen sich dann gleich mehrere Fragen: Als Wahrzeichen wofür? Und vor allem, unter dem Gesichtspunkt des Versbaus betrachtet: Warum siebenfüßig?! Klar ist, der Vers hat eine Silbe zuviel; aber statt durch sie einen zusätzlichen Versfuß in den Vers zu bringen, was die Grundbewegung des Hexameters doch stark verändert, kann man sie auch in einer Senkung verschwinden lassen:
Ungerecht / bleiben die / Männer, || und die / Zeiten der / Liebe ver- / gehen
X x x / X x x / X x || x x / X x x / X x x / X x
– Und das ist eigentlich ein tadelloser Hexameter, die zusätzliche Silbe ist kaum vernehmbar, da die drei unbetonten Silben durch die Zäsur getrennt werden?!
In der Handschrift hat Goethe gleich mehrere solcher Verse, die dann im Druck in verbesserter Gestalt erscheinen, so zum Beispiel: 1,192:
Handschrift: Immer erschien er mir herrlich und erhub mir Sinn und Gemüte
Druck: Immer schien er mir groß, und erhob mir Sinn und Gemüte
Wo neben der metrumswidrigen („groß“ statt „herrlich“) gleich auch noch eine unbedenkliche unbetonte Silbe getilgt wurde („schien“ statt „erschien“), was den Bewegungsbogen des Verses aber viel stärker beeinflusst?!
Ein anderes Beispiel (6, 50):
Handschrift: Jeder sann nur, im Herzen die Beleidigung alle zu rächen
Druck: Jeder sann nur und schwur, die Beleidigung alle zu rächen
Hier scheint die Abweichung von Hexameterton etwas stärker, und erst mit der Verbesserung bildet er sich klar und kraftvoll aus!
Jedenfalls: Wer, aus Absicht oder aus Versehen, in seinen eigenen Versen einmal eine dreisilbige Senkung in der Mitte des Verses stehen hat, durch die Zäsur unterteilt: kann sich durchaus überlegen, sie dort stehenzulassen. Das muss seltene Ausnahme bleiben, klar; aber als solche erweitert sie den Spielraum für Abwechslungen in der Grundbewegung, und das ist für den Hexameter eine wichtige Sache …
Und wenn dann doch jemand kommt und Anstoß nimmt an dem Vers, kann man es Goethe gleichtun; und darüber lachen!