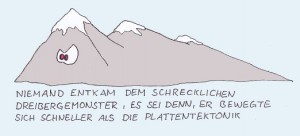Bücher zum Vers (32)
Alfred Liede: Dichtung als Spiel. Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache.
Ursprünglich gab es zwei Bände, 1992 hat deGruyter diese aber noch einmal herausgebracht, diesmal in einem einzigen umfangreichen (über 900 Seiten!) Band. Nun könnte man, da es um „Unsinnspoesie“ geht, vermuten, dass es dem Inhalt an Ernst mangelt; dem ist aber bestimmt nicht so! Liede geht sehr sorgsam vor, schaut alles in den Einzelheiten an und verknüpft und verbindet klug, so dass am Ende ein Streifzug nicht nur durch die deutsche, sondern auch durch die europäische Unsinns-Dichtung aller Jahrhunderte steht, der dem Leser sehr viel mit auf den Weg gibt! Die einzelnen Abschnitte heißen dabei zum Beispiel : „Sprachskepsis und Mystik“, „Hans Arp und der Tod“, „Der sinnlose Refrain als Zeichen ohne Bedeutung“. Das klingt schon recht gewichtig, aber andererseits lockern auch viele Beispiele den Erklärtext auf, die sehr anregend wirken; und beides, Erklärung und Beispiel, fließt zusammen; und am Ende steht ein wirklich lesenswertes Buch.
Erzählverse: Der Hexameter (40)
Paul Heyses „Thekla“ (8)
Wer mit hohem Entschlusse dem Leben entsagt und die Seele
Schon in den Tod einweihte, von Hoffnungen, Ängsten und Freuden,
Welche das Dasein füllen, sie reinigend, kaum der Errettung
Kann er sich freun, und riefe sie ihn in die Arme der Liebe,
Ihn in die Jugend zurück, wo Tag‘ und Nächte so schön sind.
Am Anfang des Gesangs ein schöner, langer, durch fünf Verse sich schlingender Satz, der klar macht, dass die gute Thekla nach dem missglückten Opfer etwas durch den Wind ist. Auch zweifelt sie: War sie nicht wert, geopfert zu werden? Jedenfalls wälzt sich die Menschenmenge zurück in die Stadt, Thekla mittendrin.
Um die Daktylen noch einmal aufzunehmen, von denen beim sechsten Gesang die Rede war: Da hatte ich ja behauptet, dass sie bei Heyse sehr leicht sind. Manchmal sind sie nun aber auch zu leicht:
Kann er sich / freun, und / riefe sie / ihn in die / Arme der / Liebe,
Ihn in die / Jugend zu- / rück, wo / Tag‚ und / Nächte so / schön sind.
Bei den Daktylen „ihn in die“ ist die betonte Silbe mit dem Fürwort „ihn“ besetzt, und das ist zum einen ohnehin eine sehr leichte Silbe, und zum anderen ist sie prosodisch nicht schwerer als die unbetonten Silben „in“ und „die“. Dadurch ist es gar nicht einfach, die Hebung zu finden, meist muss man schon Silben abzählen – und das kann ja nicht der Sinn sein! Im zweiten Vers ist diese Schwierigkeit nicht da, weil das „Ihn“ ja auf der ersten Silbe steht, und die ist ohnehin betont – alles in Ordnung!
Inhaltlich ist die Aufregung noch nicht vorbei: Die beiden Löwen, die von den Kybelepriestern gehalten werden, sind im Gewitter freigekommen und nähern sich dem Menschenzug! Alles flieht, nur die noch benommene Thekla bemerkt die Löwen erst, als sie fast schon vor ihr stehen. Sie beschließt, nicht zu fliehen:
Und mit raschem Besinnen entscheidet sie, dass sie den Feinden,
Wenn sie allein nacheilt, zu gewisserer Beute sich preisgibt,
Als mit mutigem Blick und sicherer Stirn sie erwartend.
Also geschah’s. Nachdenklich die Mähnenhäupter bewegend
Schreiten die Stolzen heran. Nun halten sie, als sie das Mädchen
Sehn, und heftig im Kreise den Schweif an die steinernen Platten
Schlagend, in staunendem Zorn betrachten sie lange die Jungfrau.
Doch nicht sinkt ihr Auge; sie hält den gewaltigen Blick aus,
Schon mit dem Tode vertraut, des glühender Flügel sie streifte.
Und so stehn sich die Drei um Speerwurfs Weite genüber,
Ferne das zaudernde Volk, das lautlos wartet des Ausgangs –
Horch, da erheben die Tiere verdrossenes Heulen, und plötzlich,
Einer dem andern nach, entweichen sie rechts in die Felder.
Auch die Begegnung mit den Löwen hat Heyse aus der Heiligen-Legende übernommen. Thekla nutzt die Verwirrung, um alleine in die Stadt zu schlüpfen. Vor dem Elternhaus findet sie den Philosophen Demas, der ihr berichten muss, dass Theklas Mutter aus Gram über den vermeintlichen Tod der Tochter gestorben ist! Thekla geht hinein, verabschiedet sich, kommt wieder und bittet Demas, sich um den Verkauf des Hauses zu kümmern; sie halte nichts mehr in Ikonium. Demas weiß, sie will dem Apostel nach. Er ist nicht begeistert:
Soll ich es selber sagen? Ich seh‘ voll Trauer, es zieht dich
Jener gefährliche Mann sich nach, um den du so viel schon
Duldetest, dem nun völlig das Herz dich Ärmste dahingibt.
Im zweiten Vers ist wieder so ein überleichter Daktylus:
Jener ge- / fährliche / Mann sich / nach, um / den du so / viel schon
Nicht, dass das jetzt ein schlechter Vers wäre – aber es ist wohl schon besser, man kommt ohne solche Daktylen aus, und noch besser, ohne Reihungen von inhaltsleeren Einsilbern wie hier:
Jener gefährliche Mann sich nach, um den du so viel schon
Thekla ist, wie zu erwarten, nicht zu halten:
Vielfach ist ja das Glück und Jeder erhofft sich das seine;
Meins ist einzig bei ihm. Was gilt die Welt und der Menschen
Schmähende Rede mir? Vor tausend Augen ein Schauspiel
Stand ich, den Heiland zeugend im Angesichte des Todes.
„den Heiland zeugend“ finde ich ja etwas missverständlich … Jedenfalls: Lästig an diesen Einsilbern ist eben auch, dass manchmal noch nicht einmal das Abzählen hilft. Der erste Vers etwa:
Vielfach / ist ja das / Glück und / Jeder er- / hofft sich das / seine;
Ich würde ihn so sprechen, mit einem Daktylus als zweite Einheit – die Silben sind so leicht, dass drei gerade reichen, um die Einheit zu füllen. Aber es würde auch so gehen:
Vielfach ist / ja das / Glück und / Jeder er- / hofft sich das / seine;
Demas ist schließlich doch überzeugt:
Und in tiefer Bewegung erwidert‘ er: gehe, wohin dein
Geist, oh Mädchen, dich ruft! Dir ist kein Warner von Nöten.
Denn dich warnt dein Sehergemüt, dich leitet die Klarheit
Deines begeisterten Muts vorbei am schwindelnden Abgrund.
…
Fahre denn wohl! Mir bleibt dein Bild wie ein Stern in der Seele.
Ganz frei von irgendwelchen Leerstellen! Und natürlich sind Heyses Verse das fast immer, nicht, dass da falsche Eindrücke entstehen.
Ich würde mich übrigens nicht wundern, wenn dem einen oder anderen diese Verse etwas kitschig vorkommen?! Ich finde sie … angemessen; was die andere Einschätzung nicht notwendigerweise ausschließt.
Das Königreich von Sede (47)
„Welke, Blume, welke!“ rief Pulverfass, des alten Königs Seher, da er zur Gießkanne griff; rief „Welke, Blume, welke!“ und goss sein Alpenveilchen; wollte seine suggestiven Kräfte üben an einer wirklichen Aufgabe. „Welke, Blume, welke!“
Erzählformen: Das Sonett (5)
„Der Tod des Priesters“ ist ein Sonett von Franz Werfel, in seinen gesammelten Werken zu finden im Band „Das lyrische Werk“ (Fischer 1967) auf Seite 422.
Gesammelt und geordnet liegt er fest,
Damit kein Tropfen Sterbens ihm entgehe.
Er will, die Hände auf die Brust gepresst,
Dass wie ein Messdienst rein sein Tod geschehe.
Die schwarze Nonne, die ihn nicht verlässt,
Kniet fern. Sein Hingang duldet keine Nähe.
Sie ministriert ihm, nun der Röchelrest
Des Atems einen Psalm singt, kurz und zähe.
Sein Auge hängt mit unnachsichtiger Strenge,
In die sich fein ein sichres Lächeln löst,
Am Winkel, wo die Spinne zieht den Faden.
Er harrt, dass dort der Engel in der Enge
Die dünne Wand der Hiesigkeit durchstößt,
Um ihn gemessenen Winkes vorzuladen.
Die Quartette sind abab / abab gereimt, statt des häufigeren abba / abba; aber das passt zu der Art, wie viermal je zwei Verse eine Einheit bilden?! Also eigentlich ein ab / ab / ab / ab. Die Terzette reimen cde / cde, und auch hier entpricht der Satzbau dieser Reimanordnung; ein Satz, eine Aussage für jedes Terzett.
An zwei Stellen wird die strenge Alternation unterbrochen: „unnachsichtiger“, „gemessenen“. Aber zum einen schadet das nichts, ein wenig Auflockerung tut immer gut; und zum anderen kann jeder, der es doch lieber im strengen Auf und Ab tönen lassen will, „unnachsicht’ger“ und „gemess’nen“ sagen …
„Wo die Spinne zieht den Faden“ klingt etwas ungelenk?! Nicht ungelenker als vieles von Werfel – er schrieb halt so -, aber in diesem Text fällt es doch auf und stört mich ein wenig. Aber eben nur ein wenig – insgesamt halte ich dieses Gedicht für ein starkes Erzähl-Sonett!
Friedhofsverse
Wind vergnügt sich bei den Steinen –
Neu, poliert, mit goldner Schrift,
Alt, bemoost und zugesifft –
Wind vergnügt sich bei den Steinen,
Doch es klingt wie leises Weinen,
Wenn er eine Kante trifft.
Erzählverse: Der trochäische Vierheber (21)
Victor von Scheffels Versepos „Der Trompeter von Säckingen“ war einmal eines der bekanntesten und meistgelesenen deutschen Bücher; heute ist er vergessen. Das sicher nicht zu Unrecht, aber ein Blick auf die Verse und die Art, wie von Scheffel sie benutzt, lohnt doch!
Das epische Gedicht beginnt mit einer „Zueignung“. Deren Anfang geht so:
„Wer ist dort der blonde Fremde,
Der auf Don Paganos Dache
Wie ein Kater auf und ab geht?“
Frug wohl manch ehrsamer Bürger
In dem Inselstädtlein Capri,
Wenn er von dem Markte rückwärts
Nach der Palme und dem maurisch
Flachgewölbten Kuppeldach sah.
Und der brave Don Pagano
Sprach: „Das ist ein sonderbarer
Kauz und sonderbar von Handwerk;
Kam mit wenigem Gepäck an,
Lebt jetzt stillvergnügt und einsam,
Klettert auf den schroffen Bergen,
Wandelt zwischen Klipp‘ und Brandung,
Ein Strandschleicher, an dem Meere,
Hat auch neulich in den Trümmern
Der Tiberiusvilla mit dem
Eremiten scharf gezecht.
Was er sonst treibt? – ’s ist ein Deutscher,
Und wer weiß, was diese treiben?
Doch ich sah in seiner Stube
Viel Papier – unökonomisch
War’s nur in der Mitt‘ beschrieben,
Und ich glaub‘, es fehlt im Kopf ihm,
Und ich glaub‘, er schmiedet Verse.“
Also sprach er. – Dieser Fremde
War ich selber; einsam hab‘ ich
Auf des Südens Felseneiland
Dieses Schwarzwaldlied gesungen.
Das liest sich einfach so weg; sichere Verse, aber nichts besonderes?! Zu einer wichtigen Frage führt allerdings dieser Zeilensprung:
Der Tiberiusvilla mit dem
Eremiten scharf gezecht.
Ein trochäischer Vierheber endet auf einer unbetonten Silbe und beginnt mit einer betonten Silbe. Das ist manchmal nicht leicht zu bewerkstelligen, und die Versuchung ist groß, ein Paar „Artikel & Substantiv“ in der Mitte durchzuschneiden; den unbetonten Artikel noch dem einen Vers zuzuschlagen und mit dem Substantiv den anderen Vers zu eröffnen – eben „dem // Eremiten“. Das kann man sicherlich machen, ist es wie hier die Ausnahme; geschieht es öfter, beginnt aber der Vers unkenntlich zu werden! Ein Beispiel dafür aus von Scheffels „Zwölftem Stück“ – die Heldin, Margareta, besucht den verwundeten und schlafenden Helden, Werner:
Leise in jung Werners Stube
Eintrat jetzo Margareta,
Scheu, neugierig schauend, ob der
Arzt ihr wahre Kunde gab.
Sanft entschlummert lag jung Werner,
Blass und jugendschön, gleich einem
Marmorbildnis. Wie im Traume
Hielt er ob der Stirn‘ und ob der
Frischvernarbten Wund‘ die Rechte,
So wie einer, der das Aug‘ vor
Blendend lichter Sonne deckt;
Um die Lippen spielt ein Lächeln.
„Ob der Stirn“ = „über der Stirn“; wichtiger aber die gehäuften Zeilensprünge: „der // Arzt“, „einem // Marmorbildnis“, „der // Frischvernarbten“, auch: „vor // blendend“ – dadurch löst sich der Vers auf, wird dem Ohr nicht mehr erkennbar, wenn der Vortragende nicht sehr tiefe und satzfremde Pausen zur Hilfe nimmt?! Nur als Silbenzählerei – „sieben, acht, Umbruch!“ – leistet der Vers aber nichts fürs Gedicht!
Da liegt also eine Gefahr; doch kann ein solcher Umbruch auch sinnvoll genutzt werden. Einige Verse später:
Doch sie mischte nicht den kühlen
Heiltrank, nicht die Arzeneien:
Beugte scheu sich zu ihm nieder,
Scheu, – sie wagte kaum zu atmen,
Dass kein Hauch den Schlumm’rer störe,
Schaute lang auf das geschlossne
Aug‘, und unwillkürlich neigten
Sich die Lippen, – doch wer deutet
Mir das seltsam sonderbare
Spiel der ersten Liebesneigung?
Schier vermuten darf der Sang, sie
Wollt‘ ihn küssen: nein sie tat’s nicht,
Schreckte jäh zusammen, – seufzte, –
Schnell sich wendend, einem scheuen
Reh gleich, floh sie aus der Stube.
„sie // wollt'“: da ist eine Pause, samt starker Betonung auf dem „wollt'“ ja durchaus dem Inhalt entsprechend und damit angemessen?! Auch noch recht wirkungsstark ist „scheuen // Reh“; schlechter steht es um „geschlossne // Aug“, auch, weil das „Aug“, das letzte Wort aus dem entsprechenden Satz ist und unschön „überhängt“. „kühlen // Heiltrank“ ist im Rahmen?! Also: Kann man machen, aber vorsichtig sein muss man …
Erzählverse: Der Hexameter (39)
Paul Heyses „Thekla“ (7)
Die zentrale Szene der Legende, daher auch ohne große verstheoretische Unterbrechung vorgestellt!
Alles strömt ins Amphitheater, obwohl das Wetter nicht das beste ist:
Da schwand völlig der Mond, ein plötzlicher Sturmwind wälzte
Hinter den Bergen hervor ein Wolkengebirg, und bedrohlich,
Wie ein geborsten Gewölb, hings über den Häuptern der Menge.
Midas will Thekla nackt und gefesselt auf dem Scheiterhaufen sehen; das mit dem Nackten weiß aber Skyron zu verhindern, und die Fesslung ist unnötig, weil Thekla den Scheiterhaufen freiwillig besteigt und sich an den Pfahl stellt. Midas hält, die Fackel in der Hand, eine Rede, und dann:
Riefs und schleudert den Brand in das Fichtengestrüpp, und die Seinen
Taten es nach. Und ein Qualm stieg auf, und es schwärmten die Funken
Knisternd im Nadelgezweig.
. Da horch! Hochher vom Gebirge
Schwang sich die Windsbraut auf und schnaubt‘ in die Tiefe. Gerölle
Riss sie vom Abhang nieder und trieb es in wütendem Wirbel
Über die Stufen hinab ins dichteste Menschengewoge.
Und sie fuhr in die Brände, zerwühlte sie, drängte mit schwerem
Odem die Gluten zurück und zerstreute die schweifenden Funken,
Dass die feurigen Zungen verloderten unten im Sande.
Doch in Purpur gehüllt, hoch unter dem Nachtfirmamente,
Raste das Wetter heran, und die Wolke zerriss, und ein Blitzstrahl
Flammte, solang wie ein Schwimmer den Hauch anhielte des Atems,
Dass in zuckendem Glanze die Nacht zum Tag sich erhellte.
Nur ein Schrei des Entsetzens erscholl ringsum in der Menge.
Denn als ließe der Berg sein felsiges Haupt von der Höhe
Rollen, den Bau zu begraben und weit zu verschütten die Ebne,
So vom Himmel erklang die betäubende Stimme des Donners
Furchtbar lange Minuten. Die Helle verschwand, und im Finstern
Dröhnte der Schall noch fort und erschütterte Mauern und Stufen.
Jetzo ein kürzerer Blitz, da brach das Gewölk, und der Regen
Prasselte laut in die Tiefe. Der Donner verscholl, von des Flutschwalls
Tosendem Heulen verschlungen. Hinaus in die ebene Landschaft
Wanderte schwer der Orkan und wälzte die Wucht des Gewitters
Über Ikonium hin und den See, und der düsteren Reise
Zeigten die Blitze den Weg.
. Im Sand, auf triefenden Sitzreihn
Lag das versammelte Volk mit geblendeten Augen und Sinnen
Wüst ineinander gewirrt. Besinnungslos in der Runde
Irrten in törichter Flucht um die Zinne des Amphitheaters
Weiber mit flatterndem Haar, am Arme die schreienden Kinder.
Und Thekla, in all der Verwirrung? Nun:
. Da wagten verschüchterte Blicke
Sich vom Boden zu lösen, und sieh, in Mitten der Bühne
Stand noch immer das Opfer und wartete willig des Endes.
Nun gut … Und die anderen? Der Prätor kommt gerade wieder auf die Beine, da
Deutet er, schaudernd erwacht, mit gebrochenem Schrei an den Boden
Neben dem Holzstoß hin. Da lag zu Füßen der Leiter
Tot, das Gesicht vom Blitze verkohlt, der Kybelepriester.
Da scheint es mir berechtigt, zu sagen: Der Himmel hat, so oder so, sein Urteil gesprochen!
Ansonsten mal wieder eine Gewitter-Szene – zu denen scheinen sich die Dichter hingezogen zu fühlen … Eine gut gestaltete?! Hm, weiß nicht. Die Verse gefallen mir, aber inhaltlich ists natürlich schon sehr das Übliche. Na, mal sehen, wie es weitergeht – noch sind zwei Gesänge zu durchschreiten!
Das Königreich von Sede (47)
Und als der Richter sagen wollte,
Wie er die Dinge sah,
Und auch, was nun geschehen sollte,
Da:
Entstieg ein Frosch dem aufgemachten Munde,
Der schaute fröhlich in die Runde
Und quakte,
Das klang, als ob er sagte:
Nicht.
Und hüpfte fort aus dem Gericht.