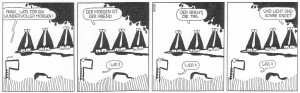„Wallensteins Lager“, von Friedrich Schiller: Das ist ein Text, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit dem Knittelvers beschäftigt! Aus dem vorangestellten Prolog, in Blankversen gehalten, habe ich ja schon unter „Der Blankvers 26“ einige Verse vorgestellt – hier, obwohl ein Knittelbeitrag, ergänze ich noch den Schluss des Prologs. Ziel ist es, den Unterschied vorzuführen zwischen einem alternierenden, reimlosen Vers wie dem Blankvers und dem Knittelvers, der danach durch die ersten Verse des eigentlichen Stücks vertreten wird.
Aber zuerst der Schluss des Prologs:
Das heut’ge Spiel gewinne euer Ohr
Und euer Herz den ungewohnten Tönen,
In jenen Zeitraum führ es euch zurück,
Auf jene fremde kriegerische Bühne,
Die unser Held mit seinen Taten bald
Erfüllen wird.
Und wenn die Muse heut,
Des Tanzes freie Göttin und Gesangs
Ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel,
Bescheiden wieder fodert – tadelt’s nicht!
Ja danket ihr’s, dass sie das düstre Bild
Der Wahrheit in das heitre Reich der Kunst
Hinüberspielt, die Täuschung, die sie schafft,
Aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein
Der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt,
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
Da ist neben Versbewegung und -klang („fodert“ stimmt so) sicherlich auch der Inhalt bedenkenswert; und auch, wie Schiller mit einem wirkungsmächtigen Sinnspruch schließt.
Nun die ersten Verse des Stücks:
BAUERKNABE.
Vater, es wird nicht gut ablaufen,
Bleiben wir von dem Soldatenhaufen.
Sind Euch gar trotzige Kameraden;
Wenn sie uns nur nichts am Leibe schaden.
BAUER.
Ei was! Sie werden uns ja nicht fressen,
Treiben sies auch ein wenig vermessen.
Siehst du? sind neue Völker herein,
Kommen frisch von der Saal und dem Main,
Bringen Beut mit, die rarsten Sachen!
Unser ists, wenn wirs nur listig machen.
Ein Hauptmann, den ein andrer erstach,
Ließ mir ein Paar glückliche Würfel nach.
Die will ich heut einmal probieren,
Ob sie die alte Kraft noch führen.
Musst dich nur recht erbärmlich stellen,
Sind dir gar lockere, leichte Gesellen.
Lassen sich gerne schön tun und loben,
So wie gewonnen, so ists zerstoben.
Nehmen sie uns das Unsre in Scheffeln,
Müssen wirs wieder bekommen in Löffeln;
Schlagen sie grob mit dem Schwerte drein,
So sind wir pfiffig und treibens fein.
– Eine ganz andere Welt! Einmal durch den Reim, aber dann auch durch die freiere Senkungs-Füllung. Während man bei den Blankversen sicher sein kann, wie stark die nächsten Silben klingen, ist beim Knittel viel nehr Abwechslung drin, und manchmal auch einiges an Unklarheit. Dieser Vers zum Beispiel:
Ließ mir ein Paar glückliche Würfel nach.
Da muss man, will man ihn der Knittel-Vorschrift entsprechend mit vier Betonungen lesen, schon einige Male ansetzen?! Aber auch bei anderen Versen gilt es zu suchen, und manchmal ist die Frage, welche Silben denn betont werden, auch schlicht nicht zu entscheiden. Trotzdem lässt sich immer eine Bewegungslinie finden, scheint mir; so dass der Vortrag lebendig und unmittelbar wirkt, während die Blankverse doch eher einen abgehobeneren Eindruck hinterlassen. Einfach mal laut sprechen, beides; und dann vergleichend urteilen!