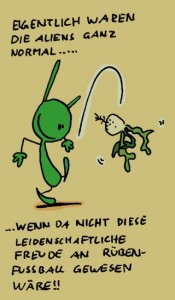Der alten Meister Waffen
Sind Wissen und Geschick
Und Freude am Erschaffen.
Erzählverse: Der Knittel (1)
Mit „Knittel“ ist die Art des Knittelverses gemeint, die seit Goethes Zeiten wieder vermehrt in der deutschen Dichtung gebraucht wurde; der „alte“ Knittelvers aus dem 15. und 16. Jahrhundert soll dagegen nur am Rande erwähnt werden.
Ein Knittel ist, rein von der Bauweise her, sehr schnell beschrieben, denn es gibt nur zwei Regeln:
– Der Knittel ist ein Reimvers. Für gewöhnlich wird der Paarreim verwendet, aber alle anderen Reimformen sind genauso möglich.
– Der Knittel enthält vier Hebungsstellen, also vier betonte Silben; die Anzahl der unbetonten Silben ist sowohl am Versanfang als auch im Versinnereren frei: Keine, eine, zwei, drei – alles ist möglich.
Dadurch scheint der Knittel ein sehr anspruchsloser Vers zu sein. Das ist aber nicht unbedingt so, denn durch den Verzicht auf das „Auf und Ab“, das im gewöhnlichen Reimvers herrscht durch den regelmäßigen Wechsel von betonten und unbetonten Silben, ergibt sich sowohl für den Verfasser als auch für den Leser die Notwendigkeit, die vier betonten Silben erst einmal aufzuspüren; wo die Betonung „sitzt“, ist nicht von vorneherein klar. Der Vers richtet sich dadurch ein Stück näher an den Anfordernissen des Satzes aus und eröffnet dem Verfasser viele neue Möglichkeiten – der Weg zum Gleichklang am Versende ist vielfältiger, die Bewegungsmuster sind zahlreicher und vielgestaltiger als im alternierenden Reimvers! Aber: Auch die Gefahren wachsen, da das Sicherungsnetz des „Auf und Ab“ fehlt und der Verfasser zum einen ein sicheres Gefühl für die Wort- und Versbewegung braucht; und zum anderen auch ein sicheres Gespür dafür, wie gut der Leser die gedachte und beabsichtigte Bewegungslinie erkennen kann und wird.
Einer, bei dem man desbezüglich keine Sorgen zu haben braucht, war Goethe. Daher hier zum Abschluss dieses ersten Beitrags ein kleiner, harmloser Text von ihm als Verdeutlichung des Gesagten; in den weiteren Beiträgen sollen dann Texte von Goethe und anderen Verfassern vorgestellt werden, die die Besonderheiten des Knittels nach und nach anschaulich machen.
Ein großer Teich war zugefroren,
Die Fröschlein, in der Tiefe verloren,
Durften nicht ferner quaken noch springen,
Versprachen sich aber, im halben Traum,
Fänden sie nur da oben Raum,
Wie Nachtigallen wollten sie singen.
Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz,
Nun ruderten sie und landeten stolz,
Und saßen am Ufer weit und breit
Und quakten wie vor alter Zeit.
Das muss inhaltlich nicht aufgedröselt werden und macht auch formal von den Freiheiten des Knittels nur mäßig Gebrauch; wichtig ist aber, dass man böse auf die Nase fällt, will man den Versen mit der Vorstellung, mit der Erwartungshaltung eines alternierenden Reimverses beikommen – denn das geht nicht, die Betonungen, immer vier, befinden sich nicht an abzählbar dafür vorgesehenen Stellen, sondern verteilen sich; mal hier, mal da, ein wenig suchen muss man immer, bevor die Bewegungslinie steht … Aber dann ist der Text auch lebendig und schön.
Hier noch eine Lesung, von Peter Härtling:
Schneewittchen
Lange bevor Schneewittchen die sieben Zwerge erspähte,
Drang aus dem dichten Wald vergnügtes Singen herüber.
„Wären all diese Berge mit ihren Graten und Klüften“,
Dachte die Königstochter, die lächelnd im Rahmen der Tür stand,
„Eine ebene Fläche, die bis in die Ferne sich dehnte;
Wären all diese Bäume mit ihren Ästen und Kronen
Gras, das vor kurzem erst der Gärtner sorgsam gemäht hat;
Sicher bezeugte die Art, wie der Zwerge ragende Hüte
Am Horizont sich zeigten, bevor ihre Träger in Sicht sind,
Einfach und leicht verständlich die Kugelgestalt des Planeten!“
Immer noch war kein Zwerg im Unterholz zu erkennen,
Doch der Klang ihrer Stimmen erscholl nun ganz in der Nähe –
Schnell ging Schneewittchen ins Haus, die Abendmahlzeit zu richten.
Bücher zum Vers (21)
Hans-Heinrich Hellmuth: Metrische Erfindung und metrische Theorie bei Klopstock
Ich glaube, dies ist ein wirklich wichtiges Buch für alle, die sich mit Fragen des Versbaus beschäftigen! Im Mittelpunkt der fast 300 Seiten stehen die von Klopstock selbst entwickelten Strophenformen, und Hellmuth zeigt ausführlich, auf welchen theoretischen Grundlagen diese Strophen beruhen und welche Grundsätze Klopstock befolgt hat, als er sich schuf; und auch, wie sich Überarbeitungen bemerkbar gemacht haben. Dazu kommen noch Ausführungen über Klopstocks „stichische“ Versmaße und die metrischen Schriften Klopstocks, so dass der Gegenstand des Buches umfassend vermittelt wird. Und da Klopstocks metrische Vorstellungen sehr anregend sind für jeden Verfasser, lohnt sich das Lesen und Durcharbeiten dieses Bandes selbst dann, wenn man Klopstock in vielem nicht Recht geben möchte und kann. Ein echter Augenöffner also, und uneingeschränkt empfohlen – allerdings nur denen, die gerne mit Srich- und Hakenformeln umgehen, denn davon ist das Buch übervoll! (Erschienen 1973 bei Fink.)
Die Bewegungsschule (12)
Jetzt geht es schon um „letzte Kleinigkeiten“; um zwei davon.
Die schwere Silbe eines tataTAM ist sein Mittelpunkt und nicht verhandelbar; bei den beiden leichten Silben sieht es, wie schon angeführt, anders aus. Möglich sind:
– Das Ersetzen der beiden leichten „ta“ durch ein „TAM“
– Das Erweitern des „tata“ zu einem „tatata“
– Das Verkürzen des „tata“ zu einem „ta“
– Das Ersetzen eines „ta“ durch eine Pause.
Die ersten drei Möglichkeiten sind schon angesprochen worden; die vierte soll hier kurz verhandelt werden. Sie verändert den Vers nicht grundlegend, ist aber eine nützliche Erweiterung.
Wenn zum Beispiel eine „Verkürzung“ sinnvoll erscheint, die grundlegende Einheit aber nicht zu leicht, zu flüchtig werden soll; dann kann die Stelle der fortfallenden leichten Silbe durch eine Sinnpause eingenommen werden, die dann dem verbleibenden zweisilbigen taTAM zu der Schwere eines dreisilbigen tataTAM verhilft.
Er bemerkte den Frosch; der starrte zurück.
Hier wird die Mittelzäsur durch eine längere Pause gebildet, die durch den recht tiefen Sinneinschnitt zustande kommt; und „Pause + ta + TAM“ ist ungefähr gleichzusetzen mit „ta + ta + TAM„.
Gut. Am Schluss noch einmal zurück an den Anfang: In Eins habe ich behauptet, dass die „TAM“ durch Sinnsilben besetzt werden sollten – Substantive, Adjektive, Verben, Adverben -, die „ta“ aber durch Bausilben – Vorsilben, Artikel, Pronomen, Hilfsverben … Das ist sicher der beste Weg, den Vers ausdrucksstark zu halten. Ein unbedingtes Muss ist aber auch diese Regelung nicht: Eine leichte Silbe kann durchaus einmal eine „TAM„-Stelle besetzen. Erst recht gilt das, wenn zum Beispiel ein Pronomen im Sinnzusammenhang hervorgehoben wird:
Hast nicht du ihn bemerkt, bist nicht du ihm gefolgt?!
Hier hat das doppelte „du“ genug Betonung, um als „TAM“ durchzugehen? Allerdings ist bei solchen Ausnahmen immer die Frage, für wen man den Vers fertigt. Kennen die Hörer und Leser den Vers, werden sie bei einer Einheit aus drei leichten Silben immer der dritten mehr Nachdruck und Dauer geben; kennen sie den Vers nicht, wird die gewählte Bewegungslinie nicht so klar erkennbar sein. Da dieser Vers selten ist, denke ich, die „TAM“ sollten so oft es geht mit Sinnsilben, die „ta“ mit Bausilben besetzt werden. Und wo das nicht der Fall ist, müssen die „Rahmensilben“ links und rechts der betreffenden Silbe verlässlich Auskunft geben darüber, wie diese Silbe zu behandeln ist!
Am Ende hilft auch hier nur: Versuchen, versuchen versuchen, dabei immer wieder hineinhören in den Vers und dann bewerten, ob die erzielte Wirkung dem Verhandelten gerecht wird oder eben nicht. Das dauert ein wenig, aber es geht ja auch darum, die eigenen Bewegungsvorstellungen nicht nur zu klären, sondern auch so aufeinander abzustimmen, dass sie erkennbar werden und vor allem überzeugen können. Das braucht etwas Zeit!
Das Königreich von Sede (36)
Als Schemel spät das Schloss erreicht,
Bleibt er am Graben stehen,
Lauscht, stutzt, lauscht wieder – ja, es streicht
Im nächtlich-kühlen Wehen
Ein sonderbar Geräusch vorbei:
Ein ausgebleichtes Flehen
Nach Ruhe, ein uralter Schrei,
Der Schemel lähmt. Er kämpft sich frei –
„Habt acht! Die Knochenfrösche!“
Erzählverse: Der Blankvers (26)
Die folgenden Verse stammen aus Friedrich Schillers Wallenstein-Prolog und sind allerdings weniger Erzähl- als vielmehr Erklär-Verse. Denn auch zu erklären vermag der Blankvers ohne Schwierigkeit, erst recht, wenn er von Schiller geschrieben wird, der dieses Geschäft hier, wie überall sonst: klar, eindringlich und nachdrücklich betreibt!
Denn schnell und spurlos geht des Mimen Kunst,
Die wunderbare, an dem Sinn vorüber,
Wenn das Gebild des Meißels, der Gesang
Des Dichters nach Jahrtausenden noch leben.
Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab,
Und wie der Klang verhallet in dem Ohr,
Verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung,
Und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk.
Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis,
Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze;
Drum muss er geizen mit der Gegenwart,
Den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen,
Muss seiner Mitwelt mächtig sich versichern
Und im Gefühl der Würdigsten und Besten
Ein lebend Denkmal sich erbaun – So nimmt er
Sich seines Namens Ewigkeit voraus.
Denn wer den Besten seiner Zeit genug
Getan, der hat gelebt für alle Zeiten.
Alles ganz klar, sehr überzeugend; nur der Zeilensprung ganz am Ende fällt etwas aus der Reihe.
Erzählverse: Der Hexameter (27)
Singe den Zorn
„Singe den Zorn“ ist eine, laut Wikipedia, ästhetisch eigensinnige Verfilmung von Homers Epos Ilias in den deutschen Versen von J.H. Voß, gedreht an Original-Schauplätzen in und um Troia. Homer also im Gewand der Voßschen Hexameter! Da lohnt doch bestimmt das Reinhören in den
Zwei etwas längere Abschnitte sind drin, einmal aus dem achtzehnten Gesang:
Siehe da kam ihm nahe der Sohn des erhabenen Nestor,
Heiße Tränen vergießend, und sprach die schreckliche Botschaft:
Wehe mir, Peleus‘ Sohn, des Feurigen, ach ein entsetzlich
Jammergeschick vernimmst du, was nie doch möchte geschehn sein!
Unser Patroklos sank; sie kämpfen bereits um den Leichnam,
Nackt wie er ist; denn die Waffen entzog der gewaltige Hektor!
Sprach’s; und jenen umhüllte der Schwermut finstere Wolke.
Ja, kann man wohl so sprechen wie es die Damen und Herren hier getan haben (wenn ich’s auch anders hielte). Bemerkenswert, dass der Versschluss hinter „entsetzlich“ so deutlich gemacht wird; dafür kommt dann eine etwas befremdliche Pause bei „Patroklos“. Warum im letzten Vers „finsterer“ gelesen wird, ist mir rätselhaft?
Sprach’s, und schändlichen Frevel ersann er dem göttlichen Hektor.
Beiden Füßen nunmehr durchbohret‘ er hinten die Sehnen,
Zwischen Knöchel und Fers‘, und durchzog sie mit Riemen von Stierhaut
Band am Sessel sie fest, und ließ nachschleppen die Scheitel;
Trat dann selber hinein, und erhob die prangende Rüstung;
Treibend schwang er die Geißel, und rasch hinflogen die Rosse.
Staubgewölk umwallte den Schleppenden; rings auch zerrüttet
Rollte sein finsteres Haar, da ganz sein Haupt in dem Staube
Lag, so lieblich zuvor! (allein nun hatt‘ es den Feinden
Zeus zu entstellen verliehn in seiner Väter Gefilde.)
Aus dem zweiundzwanzigsten Gesang. Hier werden nun die Versübergänge – zerrüttet / Rollte, Staube / Lag vollständig unbeachtet gelassen. Da hatte dann wohl auch jeder seine eigene Vorstellung … Schade auch, dass die Lesenden die „geschleiften Spondeen“, auf die Voß so viel Wert gelegt hat, weitgehend „aufgelöst“ haben: „ließ nach- / schlepp-“ ist hier so gelesen, dass „ließ“ fast unbetont ist – im Metrum ist es aber eine Hebung. Hm.
Nochmal Wikipedia: „Singe den Zorn“ gilt als einmalige gelungene Darbietung der komplizierten deutschen Hexameter.
Nun könnte man, erstens, darüber streiten, inwieweit Voß‘ Hexameter, in ihrem „griechischen Bemühen“, „deutsche“ Hexameter sind; man könnte sich, zweitens, fragen, ob deutsche Hexameter „kompliziert“ sind; und man könnte, drittens, das „gelungen“ hinterfragen. Aber gut, das geht nicht wirklich, solange man nicht den ganzen Film gesehen hat?!
Go: Die alten Meister (1)
Die alten Meister dichten
Mit Steinen, schwarz und weiß:
Bezaubernde Geschichten.