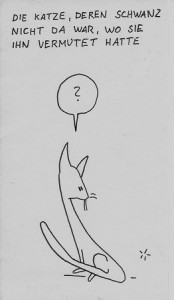Ich möchte noch einmal kurz auf den Einschnitt, die Zäsur des Trimeters zurückkommen!
1740 war Johann Elias Schlegel einundzwanzig Jahre alt und noch Student in Leipzig. In dieser Zeit hat er Aristophanes übersetzt, in Trimetern; und auch ein eigenes „Lustspiel“ in dieser Versart verfasst, „Die entführte Dose“. Dessen Anfang liest sich so:
FOPPENDORF
Triumph, Herr Bruder! Rufe doch; Triumph, Triumph!
GLOCKE
Von Herzen gerne. Tausend, tausendmal Triumph!
Triumph, mein werter, allerliebster Foppendorf!
Triumph noch einmal! – Aber nun sei auch so gut,
Und lass mich wissen, warum ich Triumph geschrien?
Ein etwas alberner Einstieg, vielleicht; den ich trotzdem mag. Wichtiger ist aber, vom Vers aus gedacht, der Umstand, dass die sehr deutlichen Einschnitte des Verses (erkennbar an den Satzzeichen) immer hinter der fünften Silbe liegen! Und das ist nicht nur zufällig bei diesen fünf Versen so, sondern das ganze Stück hindurch. Diese Festlegung der eigentlich beweglichen Zäsur macht den Vers starr, er bewegt sich anders, als wenn der Einschnitt auch immer mal wieder nach der siebten Silbe erfolgt, oder gar zwei Zäsuren vorhanden sind (Beispiele haben die früheren Trimeter-Einträge)!
Eine solche Starrheit kann gefährlich sein, weil sie das Ohr leicht langweilt und die Aufmerksamkeit von Leser und Hörer nicht gehalten werden kann. In einem lustigen Wechselgespräch, wie es diese fünf Verse enthalten, fällt das vielleicht gar nicht auf; aber in ruhigeren, längeren Abschnitten macht sich das doch bemerkbar.
Foppendorf „triumphiert“, weil er von seiner Angebeteten etwas, nun ja: „erobert“ hat, wie er es nennt, oder „ein mit Gewalt entführtes Geschenk“.
GLOCKE
Das ist was Neues! Ein Geschenke, das man stiehlt.
Was ist es aber?
FOPPENDORF
. Eine Dose! Denke doch!
Ach lieber Bruder! Eine Dose, die so oft
Den schönen Händen tausend Zeitvertreib gemacht;
Aus der sie schnupfte, wenn ihr was zuwider war;
Mit der sie spielte, wenn sie in Gedanken saß;
Die schöne Dose! die kein Silber und kein Gold,
Und keine Bänder zu bezahlen fähig sind;
So viel ich immer bei den Mägdchen lange Zeit
Geraubt, erbettelt, aus den Winkeln vorgesucht.
Von nun an rühr ich keine Dose weiter an;
Nur die ist würdig, dass sie mich zu niesen macht.
Da lässt es sich diese Auswirkung der festen Zäsur vielleicht schon besser ahnen?! Noch deutlicher zu hören ist sie am Anfang von Schlegels „Gärtnerkönig“ – der angesprochene „Alexander“ ist „der Große“:
HEPHÄSTION
Hier, Alexander, zeig ich dir den Helden an,
Den zu erwählen mir dein Wink befohlen hat.
Das reiche Sidon, das um einen König fleht,
Wünscht diese Hände, die das Grabscheid hart gemacht,
Durch seinen Zepter würdiger gebraucht zu sehn.
In seinen Adern fließt noch altes Königsblut,
Das selbst die Armut nicht beflecket noch erstickt.
Und seine Tugend hat die Ehrfurcht ihm verschafft,
Die man dem Glücke sonst nur zu bezeigen pflegt.
Der Sitten Einfalt und der Worte Niedrigkeit,
Die er als Gärtner stets nach seinem Stande misst,
Umhüllt vergebens die vortrefflichste Vernunft.
Des Geistes Adel glänzt verkleidet noch hervor,
Durch Gärtnerlippen redet eines Helden Herz.
Das ist … langweilig. Was sicher auch an der Wortwahl liegt, aber eben auch am Vers, der sich nie wirklich deutlich ausprägt in seiner Bewegung, und vor allem nicht abwechslungsreich gliedert dabei.
Johann Elias Schlegel ist früh gestorben, mit Dreißig; seine Werke hat dann sein Bruder Johann Heinrich Schlegel herausgegeben. „Die entführte Dose“ in Ausschnitten, vom „Gärtnerkönig“ nur die oben zu lesenden Verse. Zu denen schreibt Johann Heinrich in Bezug auf den festen Einschnitt nach der fünften Silbe:
Dadurch wird der Ausgang der Zäsur weiblich, oder so, dass er den Akzent immer in der vorletzten Silbe hat. Das Ausgang des Verses ist dagegen stets männlich gemacht worden, und dadurch unterscheidet sich beständig die zweite größere Hälfte des Verses von der ersten. Doch eben dieses scheint mir schon zu viel Monotonie zu haben, und es würde, wo ich nicht irre, eine völlige Freiheit besser gewesen sein, weil eine so regelmäßige, in jedem Vers vorkommende Abwechslung den Wert der Mannigfaltigkeit verliert.
Dem schließe ich mich an. Na ja, bis auf die „völlige Freiheit“, vielleicht; denn ich denke, das beste Verhältnis zwischen der dem Ohr erfreulichen „Wiedererkennbarkeit“ und der genauso erfreulichen „Abwechslung“ erreicht man, wenn man wechselt zwischen Zäsuren nach der fünften Silbe und Zäsuren nach der siebten Silbe; und immer mal wieder einen ganz anders zäsurierten Vers einfließen lässt!
Soviel dazu; im nächsten Trimeter-Eintrag steht dann wieder ein „wirklicher“ Erzähltext an, bei dem ich ein Auge auf den Zeilensprung haben möchte.