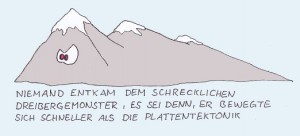„Der Tod des Priesters“ ist ein Sonett von Franz Werfel, in seinen gesammelten Werken zu finden im Band „Das lyrische Werk“ (Fischer 1967) auf Seite 422.
Gesammelt und geordnet liegt er fest,
Damit kein Tropfen Sterbens ihm entgehe.
Er will, die Hände auf die Brust gepresst,
Dass wie ein Messdienst rein sein Tod geschehe.
Die schwarze Nonne, die ihn nicht verlässt,
Kniet fern. Sein Hingang duldet keine Nähe.
Sie ministriert ihm, nun der Röchelrest
Des Atems einen Psalm singt, kurz und zähe.
Sein Auge hängt mit unnachsichtiger Strenge,
In die sich fein ein sichres Lächeln löst,
Am Winkel, wo die Spinne zieht den Faden.
Er harrt, dass dort der Engel in der Enge
Die dünne Wand der Hiesigkeit durchstößt,
Um ihn gemessenen Winkes vorzuladen.
Die Quartette sind abab / abab gereimt, statt des häufigeren abba / abba; aber das passt zu der Art, wie viermal je zwei Verse eine Einheit bilden?! Also eigentlich ein ab / ab / ab / ab. Die Terzette reimen cde / cde, und auch hier entpricht der Satzbau dieser Reimanordnung; ein Satz, eine Aussage für jedes Terzett.
An zwei Stellen wird die strenge Alternation unterbrochen: „unnachsichtiger“, „gemessenen“. Aber zum einen schadet das nichts, ein wenig Auflockerung tut immer gut; und zum anderen kann jeder, der es doch lieber im strengen Auf und Ab tönen lassen will, „unnachsicht’ger“ und „gemess’nen“ sagen …
„Wo die Spinne zieht den Faden“ klingt etwas ungelenk?! Nicht ungelenker als vieles von Werfel – er schrieb halt so -, aber in diesem Text fällt es doch auf und stört mich ein wenig. Aber eben nur ein wenig – insgesamt halte ich dieses Gedicht für ein starkes Erzähl-Sonett!