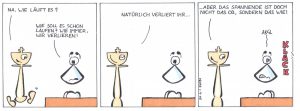Otto Ernst schildert in „Das Gesicht der Wahrheit“ einen Mann, der, vom Rat der Stadt verurteilt, am Pranger steht, nachdem ihm die Ohren abgeschnitten worden sind. Das Volk, die Menge der Schaulustigen, starrt ihn schweigend an
Und sieht um seinen Mund, den Blut benetzt,
Ein zuckend Lächeln, sieht die dunklen Haare
In feuchten Strähnen an den Wangen kleben,
Und aus den Haaren, an den Wangen nieder
Rinnt Blut, rinnt Blut – so stumm und so geschäftig,
Das warme Blut – und hilflos starrt der Kopf
Hervor aus schwarzer Wand, und hilflos irren
Die Blicke hin und her: Wo seid ihr, Hände?
Was helft ihr nicht? O wischtet ihr mir nur
Das Blut vom Mund! – Und klagend glänzt das Auge.
Einerseites Verse, die erkennbar nicht (mehr) ins Heute gehören; andererseits sind sie von einer großen Eindringlichkeit, die der Blankvers sicher mitgestalten hilft.