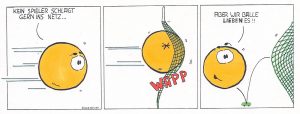Die Grundform des Hexameters, in der alle Versfüße bis auf den letzten dreisilbig sind (also schwer – leicht – leicht), ist vergleichsweise selten. Das leuchtet ein: Ein metrisch geregelter Vers lebt auch von dem Wechselspiel zwischen Wiederholung und Abwandlung, und wird die Grundform, die sonst als Vergleichsgröße im Hintergrund mitschwingt, voll verwirklicht, fällt die Abwandlung weg, und die Wiederholung herrscht! Weswegen ein solcher Vers selbstverständlich möglich ist, mehrere davon hintereinander aber selten vorkommen.
Morgen, verschlafener Morgen, wie lange noch denkst du zu schlafen?
Ein Vers im unverwechselbaren Ton Friedrich Rückerts, der hier die Grundform verwirklicht:
— ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ || ◡ / — ◡ ◡ / — ◡ ◡ / — ◡
Ein schöner Vers, der durch seine Gliederung der Eintönigkeit des Metrums entgegenwirkt. Zwei derartige Verse hintereinander klingen so:
Mich mit den Frohen zu freuen, zu schauen den herbstlichen Jubel
Bin ich herauf von den Hütten der gastlichen Freundschaft gestiegen.
– So Friedrich Hölderlin in seinem frühen Werk „Die Teck“, das noch wenig von der Sprachgewalt der späten Hexameter Hölderlins zeigt; und auch diese beiden Verse sind nicht schlecht, aber im Verbund doch ein wenig zu schnell, zu flüchtig?!
Aber ein lockenumkräuselter Knab‘, wie der lachende Amor,
Thanatos, scheinst du mir hier, in dem flimmerndem Schutte Pompejis,
Spielend mit goldigem Staub und mit Scherben zerbrochener Vasen.
Drei solcher Verse, zu finden in „Euphorion“, geschrieben von Ferdinand Gregorovius. Der Eindruck von eintöniger Flüchtigkeit hat sich sehr verstärkt, und es wunderte nicht, verlöre der Text die Aufmerksamkeit des Lesers / Hörers, ginge das über noch längere Strecken so!
Aber, wie gesagt: Ein einzelner derartiger Vers ist üblich und in seinem Verzicht auf die Abwechslung – auch selbst eine Art von Abwechslung.