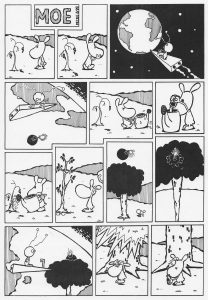„Das Märchen vom Waldfegerlein, der kleinen Marie erzählt“ stammt von Hermann Kurz und verwendet ein gutes Stück weit ausschließlich männlich schließende Reimpaare aus iambischen Vierhebern:
Waldfegerlein des Morgens fruh
Saß auf dem Zweig in guter Ruh,
Hatte die Nacht zum Schlaf genutzt,
Guckäuglein morgens hell geputzt,
Sah munter in den lieben Tag
Und sang ihn an mit süßem Schlag:
Erst sang es nur verstohlen leis,
Dann laut, herzhaft und trillerweis,
Netzt‘ in dem Tau das Schnäbelein
Und wetzt‘ es wieder am Baume rein.
Es steht über dem Text noch ein Zitat – „Ay Nachtigol, Waldvegerlain!“ Lied aus dem Kuhländchen – durchaus verständnisfördernder Art; aber eigentlich finde ich es viel spannender, ohne dieses Wissen in den Text hineinzulesen …
Warum wirken diese Verse so lebendig angesichts der geringen Abwechslung am Versende? Nun, Kurz nutzt den Versbeginn, um keine Gleichförmigkeit aufkommen zu lassen! Dort hat er Spondeen statt Iamben und versetzte Betonungen (also Trochäus statt Iambus) die Menge; sogar im Versinnern trifft man, neben zweisilbig besetzten Senkungen, eine versetzte Betonung:
Dann laut, / herzhaft / und tril– / lerweis,
◡ — / — ◡ / ◡ — / ◡ —
Das sorgt für einige Auflockerung, die aber sehr gut zum schwungvoll-verschmitzten Tonfall des Textes passt!