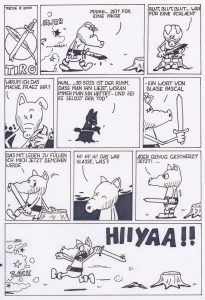Otto Knörrich (Hrsg.): Formen der Literatur in Einzeldarstellungen
Ein handlicher Band, erschienen 1981 bei Kröner, in den man aber immer noch mit Gewinn hineinschauen kann! Auf Seite 200 schreibt Frank Rainer Marx zum Beispiel über die Idylle:
Die Gattung Idylle, die in ihrer Rückbezüglichkeit auf eine vorbildhafte Natürlichkeit humanere Daseinsweisen intendiert, bewahrt stets ein kritisch-utopische Potential. Sie entwirft sinnenfrohe und liebevolle Miniaturen einer besseren Welt, die – zumindest implizit – als Kontraste zur konfliktbestimmten Realität und zur Undurchschaubarkeit zivilisatorischer Prozesse gedacht sind. Wo sie aber nicht auch Gegenbild, sondern nur noch Refugium ist, eignen ihr eskapistische Tendenzen, endet sie in heimeliger Provinzialität und Hausbackenheit.
Das ist doch eine knappe, klare und zutreffende Bestimmung, will mir scheinen?! Ich hänge noch den Anfang einer Idylle an, der „Wald-Idylle“ von Eduard Mörike:
Unter die Eiche gestreckt, im jung belaubten Gehölze
Lag ich, ein Büchlein vor mir, das mir das lieblichste bleibt:
Alle die Märchen erzählt’s, von der Gänsemagd und vom Machandel-
Baum und des Fischers Frau; wahrlich, man wird sie nicht satt.
– Fügt sich doch dieser Anfang, in Distichen gehalten und ein Buch besprechend, ganz wunderbar in die Kategorie „Bücher zum Vers“!