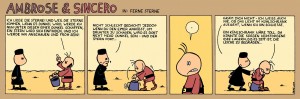Wie kommt man zu Wörtern, die Verfasser wie Leser wortvergnügt zurücklassen?! Ich denke, auf den üblichen Wegen: Man sammelt sie in den Texten, die man liest, und verwendet sie anschließend (bei passender Gelegenheit); oder man stellt sie selber her.
In Bezug auf das erste Verfahren lohnt vielleicht ein Blick in Johann Georg Hamanns (der Onkel des gleichnamigen, aber ungleich berühmteren philosophischen Schriftstellers) Poetisches Lexikon, oder, wie der Titel weiter ausführt: Nützlicher und brauchbarer Vorrat von allerhand poetischen Redensarten, Beiwörtern, Beschreibungen, scharfsinnigen Gedanken und Ausdrückungen, nebst einer kurzen Erklärung der mythologischen Namen, aus den besten und neuesten deutschen Dichtern zusammengetragen, und der studierenden Jugend zum bequemen Gebrauch mit einer Anweisung zur reinen und wahren deutschen Dichtkunst ans Licht gestellt.
In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts geschrieben, und damit zu Zeiten, in denen das Dichten ein Handwerk war, war das der „studierenden Jugend“ wirklich ein „bequemer“ Helfer: zu alphabetisch geordneten Stichwörtern gibt es eine kurze Beschreibung, von Dichtern verwendete Redensarten – und eben Beiwörter, die zuvor von Dichtern in Zusammenhang mit diesem Stichwort benutzt worden waren! Zum Beispiel finden sich zu der aus der Odyssee bekannten Calypso diese Beiwörter:
Die schöne, holde, geschickte, beglückte, zufriedene, verliebte, entbrannte, verlassne, betrübte, anmutsvolle, seufzerreiche, unsterbliche.
Nun ja. Keine besonders beeindruckende Auswahl?! Aber eins ist doch dabei, das ein wenig aufhorchen lässt: seufzerreich.
Das ist, erst einmal, selten; und damit auffällig. „Tränenreich“, ganz genauso gebildet, ist viel bekannter, aber eben auch gewohnter!
Spürt man dem „seufzerreich“ ein wenig nach, landet man in der Tat auch in der Odyssee – am Anfang des 21. Gesangs zum Beispiel findet sich, in der Prosa-Übersetzung Wolfgang Schadewaldts, dieser Satz:
Dort lagen ihr die Kostbarkeiten des Herrschers: Erz und Gold und vielbearbeitetes Eisen, dort lag auch der zurückschnellende Bogen und der Köcher, der pfeilaufnehmende, und in ihm waren viele seufzerreiche Pfeile.
Spannend! Wobei die Übersetzer, die den homerischen Hexameter im Deutschen nachbilden wollten, hier tricksen mussten, denn in der Schlussformel des Verses, dem „X x x / X x“, ist eine doppelt besetzte Senkung Pflicht:
Pfeilgefüllt; drin waren viel seufzererregende Pfeile.
So übersetzte Roland Hampe. Noch anders, aber auch mit einem Partizip, das die benötigten unbetonten Silben herbeischafft, der Klassiker Johann Heinrich Voss:
Und der Köcher, gefüllt mit jammerbringenden Pfeilen.
Wogegen nichts zu sagen ist; aber den Reiz von „seufzerreich“ haben beide Beiwörter nicht! Womit ein erster Eintrag für eine Beiwörterkladde gefunden wäre … Und auch das Bilden eigener Wörter kann hier seinen Anfang nehmen, denn Zusammensetzungen mit „-reich“ lassen sich ohne Mühe bilden, als Abwandlung schon bestehender Begriffe oder ganz frei. Statt „die zahlreich versammelten Menschen“ eben „der Menschen kopfreiche Versammlung“; einfach versuchen, alles mögliche:
Winterszeit, in der Stadt: eine nasenreiche Erkältung.
Wobei es kein völliger Zufall ist, dass die Beiwörter hier und in den anderen beiden Hexametern auf der vierten und fünften Hebung zu stehen kommen. Aber davon: ein andermal.