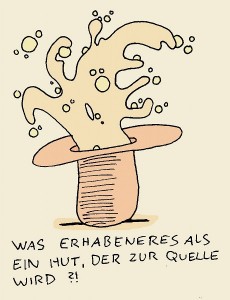Die Bewegungsschule (46)
Es ist an der Zeit, einmal wieder an den „Bewegungsschulen-Vers“ zu erinnern! Im letzten Trimeter-Eintrag ging es um Verse aus Adelbert von Chamissos „Fortunat“; der enthält aber auch eine Fülle anderer Versarten. Unter anderem finden sich ganz am Schluss des Bruchstücks, anschließend an iambische Trimeter, die folgenden Verse, in denen „Agrippina“ in höchster Verzweiflung „zurückweicht“:
Wildgrimmiger Leu du verdarbst in der Brust
Und der Liebe Gewalt und der Mitleid ganz
Richtender Gott weh, weh Rasender mir
Die zum Zorn ich gereizt den verderblichen Mann!
Denn raubte die Tat die entfliehende Zeit
Hält karg sie den Raub, und die Saat trägt Frucht
Und entschnellt, fleugt, trifft, der befiederte Pfeil
Spiel kindischer Lust ich bewege das Rad
Es im Schwung hinrollt, und erfasst und entrafft
Die erschrockene bangaufschreiende mich
Zu der Tiefe hinab.
Das ist inhaltlich ein wenig … wirr?! Auch durch die eigene Zeichensetzung. Ich kenne die Verse nun schon ein Weilchen, aber so wirklich verstanden, was in ihnen verhandelt wird, habe ich immer noch nicht. Oder nur so halb. Nun waren diese Verse ja auch gar nicht zur Veröffentlichung vorgesehen, wer weiß also, als wie „fertig“ Chamisso sie angesehen hat – aber das Unzusammenhängende hilft sicher auch, die Seelenlage der Agrippina zu verdeutlichen; und dabei hilft auch der verwendete Vers, der in seiner raschen, stürmischen Grundbewegung für diese Augenblicke höchsten Gefühls gut geeignet ist! Wer Chamissos Vers mit den bis (14) entwickelten Möglichkeiten vergleicht, stellt fest: Er bedient sich genau dieser Möglichkeiten – nur V3, der betont einsetzt, fällt aus der Reihe. Die Zäsur wird streng eingehalten; erst ganz am Schluss verzichtet ein Vers sogar völlig auf sie:
Die erschrok– / kene bang– / aufschrei– / ende mich
ta ta TAM / ta ta TAM / TAM TAM / ta ta TAM
An die Stelle des Einschnitts tritt also eine im Klang besondere schwebende Betonung, die die Versmitte im Gegenteil vollständig „vereinheitlicht“, ehe der letzte Vers, als Halbvers, dann die tiefstmögliche Pause herbeiführt, indem er schon in der eigentlichen Versmitte, dem Ort des Schnittes: schließt. Höchst eindrucksvoll!
Go: Die alten Meister (34)
Die alten Meister malen
Ein steinern Bild, aus dem
Gedankenfarben strahlen.
Erzählverse: Der Hexameter (121)
August Gottlob Eberhards „Hannchen und die Küchlein“ ist einer der kitschigsten Hexameter-Texte überhaupt; eine Probe gibt es hier beim Verserzähler unter (84) zu lesen! Trotzdem lese ich den zeimlich langen Text immer mal wieder, denn einmal pflegt Erberhard einen eigenen Hexameter, den sich vertraut zu machen lohnt (wenn er auch nicht ohne Schwächen ist); und zum anderen gibt es eben doch Einzelheiten, die aufhorchen lassen; wenige Verse nur, hier und da, die genau hinschauen und anregend beschreiben. Darunter zählt für mich die folgende Beschreibung der Küken:
Froh nun wurden zuerst in den Töpfen betrachtet die Küchlein,
Wärmung suchend und gebend, das eine gedrängt an das andre;
Manche gesenkt zum Schlummer den Kopf und geschlossen die Augen,
Aber allmählich erweckt vom laut-unruhigen Nachbar,
Plötzlich die piependen Schnäbel, die Köpfe, die Häls‘ aus den Federn
Reckend und streckend im bunten Gewühl; bald dieses, bald jenes
Hob sich erhebend im Kampf, und wieder in Federn versinkend –
Schmerzlos aber der Kampf, und der Zwist gleich wieder vergessen –
Wie sich die Wellen im See jetzt ein‘ um die andere heben,
Jetzt sie, alle versöhnt, ganz sanft ineinander verfließen.
Das trägt! Und einige Vers-Besonderheiten sind auch drin, zum Beispiel das sperrige „laut-un- / ruh-„, in dem sich Form und Inhalt auf schöne Weise ergänzen und bereichern.
Erzählverse: Der iambische Trimeter (19)
In (14) wurden assonierende Trimeter aus der Feder Friedrich Schlegels vorgestellt. Eine eigenartige Gestaltung, für die es nicht viele Beispiele gibt! In Adelbert von Chamissos (zu Lebzeiten unveröffentlichtem) „Fortunat“ findet sich allerdings ein so gestalteter „Fluch-Monolog“:
Dir Baume fluch ich, fluche tief in dumpfer Gruft
Des Hurensohnes morschen Knochen, der zur Lust
Gepflanzt dich hat inmitten dieser öden Flur,
Mitsamt der Hahnereien hochgehürnte Zunft,
Die je gekostet, oder kosten werden deine Frucht.
Den Boden, welcher deinen Wurzeln, und die Luft,
Die deinen Poren Nahrung gaben, treffe Fluch.
Doch selber mir, dem blöden Toren, der mit Wut
Verderben mir bereitet, siebenfacher Fluch!
– Und immer so weiter. Die ganze Szene ist in diesen Versen geschrieben – die ersten sechzehn assonieren auf „u“, dann folgen 19 auf „a“ assonierende Trimeter, dann 40(!), die auf „i“ assonieren … Wirkung kann man ihnen nicht absprechen, zumal Chamisso ja zumindest anfangs auch noch viele andere betonte Silben mit „u“ und „o“ hat, was dann wirklich etwas „dumpf“ klingt; aber ein seltsamer Gedanke ist es doch, und ein dem Trimeter nicht gänzlich entsprechender auch!
Erzählverse: Der Hexameter (120)
Johann Heinrich Voß gehörte zu den Verfassern, die ihre Texte nach der ersten Veröffentlichung immer und immer wieder zu verbessern suchen. Oft mit Erfolg! Die drei in (119) angeführten Verse aus der ersten Buchausgabe der „Luise“ zum Beispiel …
Aber es freute sich Karl des schreienden Wassergeflügels
Über dem Holm, und des Hechts, der beglänzt vom Abend emporsprang,
Und wie die Möw‘ hochher auf den Fisch abstürzete rauschend.
… sahen, als sie das erste Mal in einer Zeitschrift gedruckt wurden, noch so aus:
Aber es freute sich Karl des vorübergleitenden Ufers,
Und des Hechts, der vom Abend beglänzt aus dem Wasser emporsprang,
Und wie des Ruders Bild an dem Kahn in der sanften Umwallung
Schlängelte; grüßte dann laut den Wiederhall in des Hügels
Ödem Gemäu’r, liebkost’ ihm und schalt, und lachte der Antwort.
Und da gefällt mir die spätere Fassung deutlich besser: Knapper, mit deutlicher erfahrbareren Ereignissen, und auch sprachlich kräftiger und aufregender (das nachgestellte „rauschend“, etwa)! Und auch der Vers ist rhythmisch sicherer geworden: Aus dem „Und des / Hechts …“, was den Hexameter mit einem sehr schmalbrüstigen, aus zwei „Bauwörtern“ bestehenden Versfuß beginnen lässt, wird „Über dem / Holm“ – da steht zwar auch eine Präposition zu Beginn, aber die ist zweisilbig; und der Versfuß ist dreisilbig, was die mangelnde Sinnschwere der Wörter ein wenig ausgleicht; und die Sinneinheit, der Wortfuß ist ein schöner „Choriambus“, der als Einstieg in einem Hexameter immer gut wirkt! Das „und des / Hechts“ wirkt dagegen viel ungezwungener, da nun sowohl „und“ als auch „den“ in der Senkung stehen und keine Betonung tragen.
„Änderung“ heißt nicht immer „Verbesserung“; aber hier, denke ich, trifft es zu.
Erzählverse: Der trochäische Vierheber (47)
Ich schätze die Gedichte Johann Nikolaus Götz‘ sehr. Die folgenden Verse stammen aus „Bei Erblickung einer schönen Person“:
Über ihrem Scheitel gaukelt
Ein in sie verliebter Schwarm
Buhlerischer Morgenlüfte,
Die mit feuchten Fittichen
In dem Sonnenstrahle funkeln
Und ihr Tropfen hellen Taus
Auf den weißen Busen sprützen,
Wo der Überfluss sich bläht.
Vor ihr hüpft die Fröhlichkeit
In dem weißen Sommer-Kleidgen,
Und die Scherze, nebst den Spielen,
Die, gleich kleinen Engelchen,
Aus den angefüllten Schürtzgen
Mit den kleinen Götterhänden
Rosen, Veilgen, Lilgen holen
Und die Schöne, und den Pfad,
Wo die Schöne geht, bestreuen.
So selbstverständlich kann etwas klingen, das nicht übermäßig viel zu bedeuten hat – und sich nicht beschweren dürfte, bezeichnete man es als Unfug … Aber das ist eben auch wirklich gut gemacht, mit der Götz eigenen, sehr anziehenden Nachlässigkeit; Und der trochäische Vierheber, der hier einige Male auch mit betonter Schluss-Silbe steht, steuert da sicher einiges zu bei durch seine Prosanähe bei gleichzeitig deutlich spürbarer Vers-Gestaltung – der Satz, der sich durch die letzten sieben Verse zieht, ist jedenfalls ein wahres Lesevergnügen!
Erzählverse: Der Hexameter (119)
Die „Deutsche Literaturgeschichte für Lehrer“ von Hilmar Grundmann (Heinz 2001) ist ein angenehm zu lesendes Buch, nicht zuletzt, weil es auch … eher unbekannte Einzelheiten enthält! So erfährt man anlässlich Goethes „Hermann und Dorothea“:
„Diese ganz im epischen Stile Homers geschriebene Erzählung wurde von den Zeitgenossen Goethes eher kritisch aufgenommen. Das lag daran, dass die damaligen Leser in diesem Werk eher eine Nachahmung jener kleinen epischen Dichtung sahen, die Luise von Voss im Jahre 1795 herausgebracht hatte und die in der Tat einige Idyllen enthielt, die sich in ‚Hermann und Dorothea‘ wiederfinden.“ (S. 171)
Hm. „Luise von Voss“?! Die gab es wirklich, aber ich denke, hier ist eher die „Luise“ gemeint, das „ländliche Gedicht in drei Idyllen“ von Johann Heinrich Voss. Und die war Goethes Zeitgenossen in der Tat lieb und wert. Was heutzutage nicht mehr ganz einleuchtet:
Als nun rings im Gesang die kristallenen Klänge melodisch
Klingelten, plötzlich erscholl mit schmetterndem Hall vor dem Fenster
Geig‘ und Horn und Trompete zugleich und polternder Brummbass,
Eine Sonat‘ abrauschend, im Sturz unbändigen, scharfen,
Jähen Getöns, als kracht‘ einschlagender Donner aus blauem
Himmel herab, als braust‘ in den splitternden Wald ein Orkan her;
Denn an dem Hoftor hatten die Musiker leise gestimmet,
Dass unversehns aufgellte zum Gruß ein beherztes Allegro,
Eingeübt, wie freier Erguss tonreicher Empfindung.
So wie der Tön‘ Aufruhr sich empörete, klirrten die Fenster
Ringsum, dröhnte die Stub‘ und summt‘ im Klaviere der Nachklang.
Jen‘ um den Tisch frohlockten vor Lust, und alle noch einmal
Klingten sie: Hoch, hoch lebe der Bräutigam! Lebe die Braut hoch!
– Aus der letzten der drei Idyllen, und es lässt sich nicht leugnen: Das bleibt (im Gegensatz zu „Hermann und Dorothea“!) besser ungelesen. Außer selbstverständlich, man beschäftigt sich tiefergehend mit dem Hexameter; dann kommt man an einer längeren Dichtung in diesem Maß, geschrieben von einem, der auf die Ausbildung des deutschen Hexameters größten Einfluss hatte, nicht vorbei. Auch wegen der rhythmischen Schönheit und Kraft, die unter all dem inhaltlichen Geschwurbel immer zu vernehmen ist:
Aber es freute sich Karl des schreienden Wassergeflügels
Über dem Holm, und des Hechts, der beglänzt vom Abend emporsprang,
Und wie die Möw‘ hochher auf den Fisch abstürzete rauschend.
Ohne Titel
|: ◡ ◡ — —, ◡ ◡ — —, ◡ ◡ — — 😐
◡ ◡ — ◡, ◡ ◡ — —
Was da Lärm macht, ist ein Kleinkind, das herumtobt
Und sein Großvater, der stocktaub das Gesumm lobt;
Das der Bienen, die nur Schein sind.