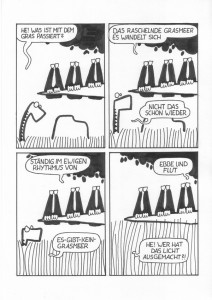Erzählverse: Der Blankvers (62)
Immer mal wieder liest man einen Text, in dem ein Witz „verreimt“ wird. Das endet so gut wie immer im Elend – ein Gedicht ist etwas ganz anderes als ein Witz, und Reime machen aus einem guten Witz kein gutes Gedicht, sondern einfach nur einen schlechteren Witz (weil die unbarmherzige Kürze aufgegeben wird zugunsten eines Gleichklanggeklingels, das diesem Grundgedanken des Witzes völlig zuwiderläuft).
„Einfach so“ lässt sich eigentlich gar nichts in Verse fassen?! „Der Engel des Todes“ von Sophie Mereau-Brentano liest sich so:
An Salomon dem großen Weisen ging
Der ernste Todesengel sichtbarlich
Vorüber einst, und richtete den Blick
Auf einen Mann, der nahe bei ihm stand.
Wer ist der, fragte dieser Salomo,
Der Engel mit dem furchtbar ernsten Blick?
Der Todesengel, sagte Salomo.
Es scheinet mir, versetzte jener, dass
Er mein bedarf; o, so befiehl drum schnell
Dem Winde, dass er weit aus seinem Blick
Nach Indien mich bringe. Es geschah.
– Und drauf zu Salomo der Engel spricht:
Verwundert sah ich ernst auf diesen Mann,
Denn seine Seel‘ in Indien von ihm
Zu nehmen, war befohlen mir, und hier
In Palästina traf ich ihn bei dir.
Hm. Wenn das gutgegangen ist, wenn die alte Geschichte hier wirklich Gedicht geworden ist: dann gerade eben so.
Ohne Titel
In mir hat sich die Zeit empört, der Stunden Zorn bin ich,
So dachte ich, und dachte auch: Du machst dich lächerlich.
Erzählverse: Der trochäische Vierheber (45)
Eine Fliege in einer Flasche
Sahst du denn in einer Flasche
Niemals eine Fliege flattern,
Die sich durch die enge Mündung
In das Glas verflogen hatte?
Nun, so wirst du auch begreifen,
Wie die kleinen Liebesgötter
Es in meinem Herzen treiben.
Durch die offnen Augen haben
Sie sich da hinab gestohlen,
Aber schon wird es darinnen
Ihnen viel zu eng und bange,
Und sie flattern so unbändig,
Dass ich Tag und Nacht vor ihnen
Keine Stunde Ruhe habe.
– Kann man heute nicht mehr schreiben, ich weiß. Schade eigentlich! Die Selbstverständlichkeit und Gelassenheit, mit der Wilhelm Müller hier „aus Nichts Etwas macht“, stünde manch heutigem Text ganz gut zu Gesicht, dessen „Etwas-Gelten-Wollen“ dem Leser und dem Hörer oft unangenehm aufstößt … Wie ein solcher Text im 21. Jahrhundert aussehen könnte, das bliebe dann freilich noch zu ergründen!
Bücher zum Vers (75)
Ulrich Hötzer: Mörikes heimliche Modernität.
In diesem 1998 bei De Gruyter erschienenen Band findet sich vieles lesenswertes, ich möchte aber vor allem hinweisen auf „Grata negligentia“ – „Ungestiefelte Hexameter“? Bemerkungen zu Goethes und Mörikes Hexameter. Da gibt es auf über 30 Seiten nicht nur sehr viel über Goethe und Mörike zu erfahren, sondern vor allem ungemein wissenswertes über den Hexameter an sich. Wer sich mit diesem Vers beschäftigt, sollte Hötzers Text unbedingt lesen! Er ist zum allergrößten Teil auch im Netz einsehbar: Hier.
Beide Dichter haben ein sicheres Gespür für das rein Epische des Hexameters. Mit stets gleichbleibender Gebärde stellt dieser Vers, unendlich gereiht, Welt vor den Leser oder Hörer hin, und der gleichartige, aber nie identische Rhythmus spricht stets dieselbe Bewusstseinsebene an: aus dem Abstand betrachtende Anteilnahme. Das wird noch deutlicher, wenn wir den stichischen Hexameter mit dem elegischen Distichon vergleichen, wo der beruhigende Fluss des Hexameters durch den Gegenschlag des Pentameters unterbrochen wird. Der ständige Wechsel von gelassener Betrachtung und erregter Anteilnahme schafft im Hörer eine andersgeartete, intensivere Bewusstseinslage, eine Art „gebrochener Anschauung“. Das Distichon bildet Welt und reflektiert sie zugleich im Fühlen oder Denken. (…) Der Hexameter dagegen stellt dem Hörer Welt gegenüber als reine, ungemischte und ungebrochene Gegenwart.
– Eine meiner Lieblingsstellen (auf den Seiten 75 und 76 zu finden), die ich seit Jahren bei passenden (und wahrscheinlich auch weniger passenden!) Gelegenheiten anzuführen pflege … Aber ich denke halt, Hötzer hat sehr Recht mit dem, was er da schreibt, und ein sicheres Verständnis dieser „Wesensmerkmale“ hilft beim eigenen Schreiben unbedingt!
Erzählverse: Der trochäische Fünfheber (7)
Ein Kanadier, der noch Europens
Übertünchte Höflichkeit nicht kannte
Und ein Herz, wie Gott es ihm gegeben,
Von Kultur noch frei, im Busen fühlte,
Brachte, was er mit des Bogens Sehne
Fern in Quebecs übereisten Wäldern
Auf der Jagd erbeutet, zum Verkaufe.
Als er, ohne schlaue Rednerkünste,
So wie man ihm bot, die Felsenvögel
Um ein Kleines hingegeben hatte,
Eilt‘ er froh mit dem geringen Lohne
Heim zu seinen tiefverdeckten Horden,
In die Arme seiner braunen Gattin.
So beginnt Johann Gottfried Seumes „Der Wilde“. Das ist nun keine Geschichte, die heute noch weithin bekannt zu sein verdiente; aber die Art, wie Seume den fünfhebigen Trochäus verwendet, ist doch einen Blick wert, scheint mir. Zwei lange Sätze füllen einmal sieben, einmal sechs Verse, was ja auf eine gewisse Spannung zwischen den Größen zu deuten scheint; doch spricht man die Verse laut, ist es schwer, sie lebendig und ausdrucksstark klingen zu lassen … Vielleicht liegt es darin, das zwar der Satz erfahrbar wird, der Vers aber sehr blass bleibt?!
Ohne Titel
Es gibt ein Wort, das ganz genau beschreibt,
Wie sich das frühe Licht in Honig bricht,
Darin der toten Fliege Schatten treibt –
Es gibt dies Wort, und niemand kennt es nicht.
Erzählverse: Der Blankvers (61)
„Der Tapfere“ von Johann Gottfried Herder erzählt eine Geschichte; aber der Text hat es nicht eilig damit. Erst einmal ergeht er sich im Langen und Breiten über das Wesen des Heldentums:
Ein böses Heldentum, wenn gegen Mensch
Der Mensch zu Felde zieht. Er dürstet nicht
Nach seinem Blut, das er nicht trinken kann;
Er will sein Fleisch nicht essen; aber ihn
Zerhaun, zerhacken will er, töten ihn! –
Aus Rache? Nicht aus Rache: denn er kennt
Den Andern nicht, und liebet ihn vielleicht.
Auch nicht sein Vaterland zu retten, zog
Er fernen Landes her. Ein Machtgebot
Hat ihn hieher geführet; roher Sinn,
Die Raubsucht, Sucht nach höhrer Sklaverei.
Von Wein und Branntwein glühend, schießt er, sticht
Und haut und mordet; mordet – weiß nicht, wen?
Warum? wozu? bis beide Helden dann,
Verbannt ins Schloss der Unbarmherzigkeit,
Ein Krankenhaus, mit andern Hunderten
Daliegen ächzend; und sobald den Krieg
Not und der Hunger endet, alle dann
Als Mörder-Krüppel durch die Straßen ziehn
Und betteln. Ach, sie mordeten um Gold,
Gedungne Helden aus Tradition.
Kein lyrischer Ton, mehr gepflegte Plauderei – die aber trotzdem durch den streng durchgeführten iambischen Fünfheber zusammengehalten wird?! Der letzte Vers ist dabei ein klein wenig knifflig zu lesen, aber das liegt an dem etwas unschönen Wort „Tradition“! Langeweile kommt jedenfalls nicht auf. Weswegen Herder auch weiterhin nicht zur eigentlichen Geschichte kommt, sondern „wahres Heldentum“ zu beschreiben beginnt:
Ein edler Held ist, der fürs Vaterland,
Ein edlerer, der für des Landes Wohl,
Der edelste, der für die Menschheit kämpft.
Nach diesen sinnspruchartigen Zeilen geht es dann, ganz langsam! wirklich zur eigentlichen Geschichte. Die lasse ich hier aber weg; Zweck des Beitrags ist schließlich, zu zeigen, wie auch gekonntes „Welterklären“ im Blankvers sein Zuhause hat und dank des Verses bei aller Freiheit der Gedanken, hierhin und dorthin zu wandern, doch immer gestaltet wirkt.