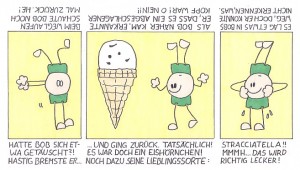Paul Heyses „Thekla“ (4)
Der Hexameter ist zur Bewegungs-Vielfalt nicht nur in der Lage, sondern ihr geradezu verpflichtet! Er sollte:
– sich in der Abfolge von zweisilbigen und dreisilbigen metrischen Einheiten von Vers zu Vers unterscheiden.
– sich in den Hauptzäsuren, den Sinneinschnitten innerhalb der dritten oder vierten metrischen Einheit, von Vers zu Vers unterscheiden.
– metrische Einheiten und Sinneinheiten nicht deckungsgleich aufeinanderfallen lassen.
– Innerhalb des Verses möglichst unterschiedliche Sinneinheiten bilden, und möglichst nie mehr als zwei gleiche aufeinanderfolgen lassen.
Bei soviel verschiedenen Möglichkeiten, den Vers zu gestalten, stellt sich natürlich die Frage: Woran ist der Hexameter denn dann überhaupt noch dem Ohr erkennbar – was ist die immergleichbleibende Grundgröße, die auf jeden Fall wiedererkannt wird?
Einen gewichtigen Anteil an dieser Wiedererkennbarkeit hat sicherlich die sich immer gleichbliebende Schlusswendung „X x x / X x“ – weswegen sie auch eine wichtige Stelle des Verses ist und sorgfältig behandelt werden muss. Mal sehen, wie Heyse das macht im vierten Gesang der „Thekla“!
Der beginnt damit, dass sich das „einfache Volk“ über den Apostel austauscht.
Besser, wir schicken geheim ihm Botschaft, bieten ihm Geld an.
Wer am mächtigsten ist, mit dem sich gütlich vertragen,
Dünkt mich immer das klügste, es sei nun, dass er ein Gott ist,
Oder ein Mensch; denn ein Gott ist jeglicher, der die Gewalt hat.
Diese vier Verse führe ich an, weil in dreien von ihnen die Schlussformel durch einen davor liegenden Sinneinschnitt deutlich gekennzeichnet wird:
Besser, wir schicken geheim ihm Botschaft, bieten ihm Geld an.
Wer am mächtigsten ist, mit dem sich gütlich vertragen,
Dünkt mich immer das klügste, es sei nun, dass er ein Gott ist,
Oder ein Mensch; denn ein Gott ist jeglicher, der die Gewalt hat.
Im zweiten Vers klingt die Schlusswendung nicht ganz so deutlich durch (ist aber natürlich vernehmbar). Dieser Vers ist auch der einzige, in dem die letzte Silbe ein „schwaches e“ als Vokal hat. Das ist darum von Bedeutung, weil man ein wenig darauf achten muss, nicht zu viele von diesen schmalbrüstigen Vokalen dabei zu haben, weil der Vers bei einem solchen „schwachen e“ nicht ausschwingen kann, sondern mehr „in sich zusammenfällt“; und wenn das über viele Verse nacheinander geschieht, bekommt der Vortrag schnell etwas bemühtes, stockendes, es ist ein dauerndes Ab- und wieder Ansetzen hörbar.
Ich zeige das an ein paar Thekla-Versen. Der Apostel, der im übrigen Tryphon heißt, und sein Gastgeber Nathanael erhalten Besuch, von Midas, dem obersten Kybele-Priester. Der versucht den Apostel einzuschüchtern, doch:
Wenn mich Menschen erschreckten, ich wäre unwürdig der Gnaden
Gottes des Herrn, der stark mich schirmt in drängender Fährde,
Wie er auch heut erst wieder den Feind mit Lähmung geschlagen.
Darum wird kein Schnauben des Zorns mich irgend erschüttern;
Denn ich wandle, wohin mich der Odem des Herrn will tragen,
Der die Fichten im Walde zerbricht und die Wolken dahintreibt
Und die erkorenen Boten umherführt unter den Völkern.
Schon erstaunlich, wie stark das „-treibt“ des vorletzten Verses sich heraushebt aus den anderen schwachen Schluss-Silben! Ich denke, wenn man alle vier, fünf Verse etwas Abwechslung reinbringt, bekommt das Ganze ein schönes Gleichgewicht … Im drittletzten Vers ersetzt Heyse die Schlussformel „X x x / X x“ wieder einmal durch „X x / X x“ – das hatten wir ja schon. Für meinen Geschmack macht er das etwas zu oft – er stört dadurch eben die Wiedererkennbarkeit des Vers-Schlusses. Klar ist das erlaubt seit Homers Zeiten, doch bei den meisten Dichtern liegt die Häufigkeit um die zwei Prozent …
Inhaltlich lässt Midas die Maske fallen, nachdem Nathanael gegangen ist, und schlägt Tryphon ein Geschäft vor: Geld gegen das Verlassen der Stadt. Dem Gottesmann platzt natürlich der Kragen! Midas zieht wütend ab und wird von Thekla beobachtet; sie wirft dem Apostel eine Warnung ins Zimmer. Dann stellt sie fest, dass niemand im Haus mehr mit ihr redet. Erst abends erbarmt sich eine alte Dienerin und weiß zu berichten, dass Tryphon von der römischen Staatsmacht gefangengenommen und eingekerkert wurde! Jedoch, nach dem Abgang der Alten:
Und nun saß in der Nacht, die mit ruhigen Sternen hereinsah,
Thekla wieder allein und atmete tiefer und leichter.
Denn sie weiß jetzt, was zu tun ist: Sie will den Apostel aus dem Gefängnis retten!