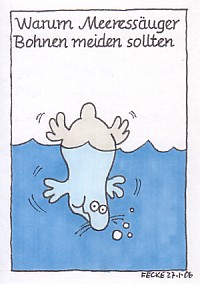Die Bewegungsschule (17)
Das TAMtaTAM kommt in vielen Versarten vor – zwar tut sich der hier in der Bewegungsschule vorgestellte Vers schwer damit, aber in alternierenden Versen ist diese Bewegung häufig, und auch in den Hexameter fügt sie sich ohne Schwierigkeiten ein.
Jedenfalls, solange es sich um ein einzelnes TAMtaTAM handelt! Will man es zwecks Wirkungsverstärkung verdoppeln, geht das weder im Hexameter noch im „Auf und Ab“-Vers. Ausnahme ist da der trochäische Vierheber, wo diese Verdopplung häufig unter Ausfall einer unbetonten Silbe erreicht wird, meint: aus „TAM ta TAM ta TAM ta TAM“ wird
TAM ta TAM || TAM ta TAM
Ein schönes Beispiel für die Wirkungen, die sich damit erreichen lassen, ist Christian Morgensterns „Das Wasser“:
Ohne Wort, ohne Wort
rinnt das Wasser immerfort;
andernfalls, andernfalls
spräch es doch nichts andres als:
Bier und Brot, Lieb und Treu, –
und das wäre auch nicht neu.
Dieses zeigt, dieses zeigt,
dass das Wasser besser schweigt.
So reichlich wie hier, in jeden zweiten Vers also, kommt diese Erscheinung eher selten vor, aber die Wirkung der Bewegungs-Verdopplung, dreimal mit gleichzeitiger Inhalts-Verdopplung, einmal ohne: wird dadurch doch sehr deutlich?!
Morgenstern hat das TAMtaTAM auch sonst gerne eingesetzt. Wieder gedoppelt, und in Verbindung mit dem verwandten TAMtataTAM steht es zum Beispiel in „Auffahrt“, in diesem Ausschnitt:
Mit Wellenhunden
fällt euch an
der Hass der Höhe
wider das Tal.
Aber ihr fliegt,
blutbespritzt,
unbesiegt
empor, empor.
Wieder die Verdoppelungen, ab „wider …“:
TAM ta ta TAM / TAM ta ta TAM / TAM ta TAM / TAM ta TAM / ta TAM / ta TAM.
– wobei die letzten beiden Glieder von Umfang und Bewegung her schwächer sind, dafür aber inhaltlich übereinstimmend.
Der gesamte Text ist deutlich länger, besteht aber durchgängig aus Versen mit zwei betonten Silben. Dank der ohne Regel davor, dazwischen und dahinter eingefügten unbetonten Silben ergeben sich alle nur denkbaren Bewegungslinien, die zwei Betonungen enthalten, und dadurch ist das ganze Gedicht lohnender Anschauungsstoff, will man über die Bezüge, die Wirkungen zwischen diesen Bewegungslinien nachdenken; genau wie andere Gedichte dieses Aufbaus, von Morgenstern und anderen Verfassern.
Go: Die alten Meister (8)
Die alten Meister kennen
Den Spruch: Vergesst die Jagd,
Wenn eure Häuser brennen.
Genau betrachtet
Sommer lag auf der Stadt, als sich Heinrich ans offene Fenster
Setzte, um früh am Morgen der fröhlichen Menschenmenge
Zuzusehen, die draußen die Einkaufsstraße belebte.
Sicher, es war das Fenster, genau betrachtet, geschlossen,
Was die Gespräche, die Rufe, das fröhliche Lachen der Kinder
Nicht in das Zimmer ließ, und eigentlich gab es kein Fenster,
Welcher Umstand die Farben, das Licht, die Bewegungen fernhielt;
Heinrich schaute stattdessen die weißgestrichene Wand an,
Hinter der, möglicherweise, die Einkaufsstraße sich dehnte
Oder eben auch nicht. Je nun, das geht so in Ordnung,
Dachte Heinrich, denn gibt es die Straße, was könnt‘ ich an diesem
Abend schon sehen, in Regen und Kälte, mitten im Winter?
Bücher zum Vers (28)
Walther Killy: Wandlungen des lyrischen Bildes
In diesem kleinen, handlichen Bändchen wird die Frage nach dem Wesen des Bildes bei Goethe, Hölderlin, Brentano, Mörike, Trakl, Benn und Brecht gestellt und anhand vieler Gedichte beantwortet; dabei bleibt der Blick immer auf den Veränderungen, die das dichterische Bild dabei durchmacht. Ich fand das ganze sowohl inhaltlich beachtlich als auch angenehm zu lesen, kann schon älteren Band (zuerst 1956 erschienen bei Vandenhoeck & Ruprecht) also durchaus empfehlen. Etwas lästig ist, dass Killy für die gelegentlichen englischen und französischen Zitate keine Übersetzung beigibt (für die altgriechischen schon), aber das ist verschmerzbar.
Ein kurzer Abschnitt über Georg Trakls Dichtung, der einen ersten Eindruck gibt:
Wir haben es mit einer Welt reiner Poesie zu tun, welche die alten Dinge und Bilder als Chiffren für ihre immanenten Beziehungen, für ihre schwermütig-herrlichen kaleidoskopischen Spiele benutzt. Auf diese Weise bringt Trakl den deutschen Vers nochmals zum Sprechen und die Bilder zum rätselhaften Leben. Es geht ein großer Reiz vom Vertrauten aus, wenn man es zum Geheimen verwandelt findet. Aber die Sprache kommt an eine Grenze, jenseits derer die völlige Auflösung der realen Zusammenhänge und des Sinns des Wortes liegt, das Weltbemächtigung und Mitteilung will.
Die Bewegungsschule (16)
Da der letzte „Bücher zum Vers“-Eintrag von Klopstocks Eislaufoden handelte, ist es vielleicht ein brauchbarer Gedanke, einmal eine dieser Oden vorzustellen?!
Ich nehme gleich die erste, „Der Eislauf“ aus dem Jahre 1764; deren metrischer Aufbau schließt nämlich an das an, was zuletzt hier in der Bewegungsschule verhandelt wurde:
ta TAM ta TAM ta TAM ta ta TAM
ta ta TAM ta TAM ta TAM ta ta TAM
TAM ta TAM / TAM ta ta TAM / TAM ta TAM
TAM ta ta TAM / TAM ta ta TAM
Die ersten beiden Verse bieten nichts besonderes – solche Bewegungslinien gibt es sehr häufig. Vers vier ist derselbe Vers, der schon kurz Gegenstand war hier in der Bewegungsschule: das doppelte TAMtataTAM. Der dritte Vers bietet aber etwas wirklich neues: Wieder ein TAMtataTAM, aber diesmal eingerahmt von zwei TAMtaTAM!Eine strenge Spiegelbildlichkeit, bei der durch die zahlreichen schweren Silben, die aufeinander folgen (nicht nur im jeweiligen Vers, auch im Übergang von V2 auf V3 und V3 auf V4), sich die Bewegung deutlich staut; langsamer wird.
Wie sieht das nun im wirklichen Gedicht aus? Ich zeige dazu die siebte Strophe:
Sein Licht hat er in Düfte gehüllt,
Wie erhellt des Winters werdender Tag
Sanft den See! Glänzenden Reif, Sternen gleich,
Streute die Nacht über ihn aus!
Sein Licht hat er in Düfte gehüllt,
Wie erhellt des Winters werdender Tag
Sanft den See! / Glänzenden Reif, / Sternen gleich,
Streute die Nacht / über ihn aus!
Keine Frage: Die letzten beiden Verse bewegen sich auf eine besondere Weise. Wie aber hört sich das im wirklichen Vortrag an? Hier eine Lesung von Clemens von Ramin (und auch der Text der Ode):
Für diese Strophe entspricht der Vortrag dem zugrundeliegenden Aufbau. Im Vergleich mit anderen Strophen zeigt sich aber, dass dies der großen Stärke der Silben geschuldet ist, die die „schweren“ Planstellen besetzen; da gibt es einfach keine andere Möglichkeit. Sind aber diese Stellen nur ein wenig schwächer besetzt, liest von Ramin die entsprechenden Silben „leicht“ – vierte Strophe:
Unsterblich ist mein Name dereinst!
Ich erfinde noch dem schlüpfenden Stahl
Seinen Tanz! Leichteres Schwungs fliegt er hin,
Kreiset umher, schöner zu sehn.
– Das „seinen“ wird nahezu ohne Betonung gelesen. Vielleicht kann man das so machen, auch im Rest der Ode; aber ich finde es doch schade, dass auf diese Weise einmal die Bewegung an sich nicht so gut herauskommt, zum anderen aber auch die deutliche Trennung zwischen erster und zweiter Strophenhälfte verwischt wird (von dem Unstand, dass ein stärker betontes „Sei-“ auch den Sinn etwas verschiebt, nicht zu reden). Ganz besonders heftig geschieht dies in der letzten Strophe:
Den ungehörten Wogen entströmt,
Dem geheimen Quell entrieselt der Tod!
Glittst du auch leicht, wie dieß Laub, ach dorthin;
Sänkest du doch, Jüngling, und stürbst!
Von Ramin ergänzt eine Silbe – aus „glittst“ wird „glittest“ – und liest ausschließlich die Satzteilung:
Glittest du auch leicht, wie dies Laub, ach dorthin;
– wodurch sich eine höchst unübliche Einheit ergibt, „TAM ta ta ta TAM„, „Glittest du auch leicht„! Der ganze Vers klingt dabei gar nicht schlecht:
TAM ta ta ta TAM / ta ta TAM / TAM ta TAM
Ich bezweifle allerdings, dass dies Klopstocks Absichten entspricht …
Aber am Ende muss sicherlich jeder Vortragende seine eigenen Vorstellungen umsetzen. Und solange bei der Ausbildung derselben das Nachdenken über die Bewegung – gerade für Klopstock-Texte sehr wichtig – nicht zu kurz kommt, steht am Ende ziemlich sicher ein Vortrag, der nicht immer gefallen wird, aber doch, meistens: nachvollziehbar ist.
Das Ein-Vers-Gedicht (7)
Ein handelsüblicher Endreim verknüpft zwei Verse mit einem Gleichklang. Was aber, wenn nur ein Vers vorhanden ist wie im Einvers-Gedicht?! Dann müssen sich wohl oder übel die Bereiche dieses einen Verses reimen – zum Beispiel der Anfang und das Ende:
Töpfe sind auch Kunstgeschöpfe.
– Sagt Wilhelm Busch in seinen „Sprüchen“. Das sind zwar eher Prosa-Texte, aber sei’s drum: Die Verbindung von Versanfang und -ende ist eine bedenkenswerte Gestaltungsmöglichkeit! Das kann auch durch anderes als den Reim geschehen:
Schinkenessen ist indirektes Schweineschlachten.
Wieder von Busch, wieder Prosa, diesmal aber aus einem seiner Briefe; vorne und hinten steht gestaltend und einen Rahmen setzend jeweils ein Dingwort der Form und Bewegung „X x X x“!
Anagramm-Geplauder (1)
„Distichen“. Kein Wort, von dem man auf den ersten Blick annehmen würde, es bietet viele spannende Anagramme; aber einige lassen sich doch finden!
„Identisch“ zum Beispiel – was aber inhaltlich nicht so wirklich passt, denn zwei Distichen sind ja aufgrund der verwendeten Verse, Hexameter und Pentameter, eben nicht „identisch“, sondern höchst verschieden voneinander; jedenfalls verschiedener als so gut wie alle anderen Formen.
Also vielleicht „Ich-Dienst“? Das gilt für alle anderen Gedichte mindestens genauso – auch nicht sehr überzeugend …
Allemal sinnvoll sind dagegen die möglichen „Aufforderungs-Anagramme“:
„Distichen? Dicht eins!“
„Dicht es in Distichen!“
Dem komme ich selbstredend nach. Aber welcher Gegenstand soll verhandelt werden? Die Versbewegung bietet sich an. Womit anfangen? Da hilft wieder ein Anagramm – ich wähle mir „Seid nicht“:
Den Freunden der Dichtung
Seid nicht nur Auge; seid Ohr, seid redende Zunge, damit ihr,
Wenn sich ein Vers bewegt, diese Bewegung auch spürt!
Wer nun selbst ein Distichon dieser Art versuchen möchte – Anagramm-Anfänge sind noch einige verfügbar. Wo „Seid nicht“ ist, ist auch „Nicht dies“, und andere mehr. Schlechter dagegen sieht es mit Ding-Wörten aus, da bietet die Anagramm-Liste nicht viel an. Eine der wenigen Möglichkeiten ist „Neid-Stich“, ein Gefühl und eine Erfahrung, die zumindest menschlich wären beim Betrachten der meisterhaften Distichen, die unsere Dichtergrößen erschaffen.
Der junge Tod
Ich habe meinen Tod gesehen,
Heut Nacht, im Schlaf;
Ganz klein sah ich ihn liegen,
In einer jener Wiegen,
Wie sie in allen Häusern stehen –
Doch diese war tiefschwarz.
Ich habe ihn erschreckt:
Nach einer Sense, die im Schatten stand,
Hat er die kleine Knochenhand
Verlangend ausgestreckt,
Und hat geweint, als er sie nicht erreichte,
In einem Ton, der meine Seele traf.