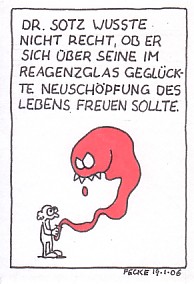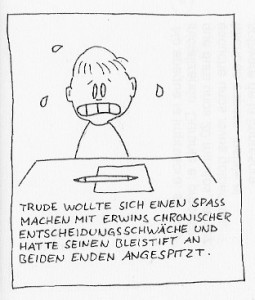Erzählverse: Der Hexameter (24)
Warum Heine keine Hexameter geschrieben hat
weiß Maximilian Heine in seinen Erinnerungen an den älteren Bruder zu berichten:
Mein Bruder Heinrich war mehrmals gegenwärtig, wenn ich, als Primaner des Gymnasiums, meine prosodischen Arbeiten anfertigte. Ich hatte damals eine große Vorliebe für das klassische Metrum und durch vieles Übersetzen und tägliche Übung eine außerordentliche Leichtigkeit in Anfertigung von deutschen Distichen erlangt. Obgleich Heinrich die Alten besonders hochschätzte und bereits damals durch seine Gedichte einen großen Namen als Poet erworben hatte, so hatte er sich doch im deutschen Hexameter bisher nie versucht. Wir sprachen viel über diesen Gegenstand. Ich zitierte Goethes herrliche Elegien und forderte meinen Bruder auf, auch einmal in diesem Versmaße einen Gegenstand poetisch zu bearbeiten. Ich wiederholte mehrmals Goethes reizenden Vers, wo er auf den Nacken der Geliebten „mit fühlendem Auge und sehender Hand“ des Hexameters Maß skandiert hat.
Endlich ging Heinrich an die Arbeit, und als ich an einem der nächsten Vormittage in sein Zimmer trat, kam er mir mit einem Blatt entgegen, freudig ausrufend: „Siehst Du, auch ich bin unter die Hexameter gegangen.“ Er rezitirte mir einige Zeilen eines Gedichtes: „Trost für Dito“, wobei ich aber schon beim dritten Hexameter (keine kleine Satisfaktion für einen Primaner) dem bereits berühmten Dichter in die Rede fiel: „Um Gottes Willen, lieber Bruder, dieser Hexameter hat ja nur fünf Füße.“ Und nun skandierte ich ihm mit wichtigster Schulweisheit den Vers vor. Als er sich vom Fehler überzeugt hatte, zerriss er leider das Papier mit den Worten: „Schuster, bleib bei Deinem Leisten!“
Ein paar Tage nach dieser Begebenheit, wovon übrigens nicht mehr gesprochen worden war, stand eines Morgens früh, als ich eben aufwachte, Heinrich vor meinem Bette. „Ach, lieber Max,“ begann er mit kläglicher Miene, „was für eine schauerliche Nacht hab’ ich gehabt.“ Ich erschrak. „Denke Dir, gleich nach Mitternacht, eben als ich eingeschlafen war, drückte es mich wie ein Alp; der unglückliche Hexameter mit fünf Füßen kam an mein Bett gehinkt und forderte von mir unter den fürchterlichsten Jammertönen und selbst schrecklichsten Drohungen seinen sechsten Fuß. Ja, Shylock konnte nicht hartnäckiger auf sein Pfund Fleisch bestehen, als dieser impertinente Hexameter auf seinen fehlenden Fuß. Er berief sich auf sein urklassisches Recht und verließ mich mit schrecklichen Gebärden nur mit der Bedingung: dass ich nie wieder im Leben mich an einem Hexameter vergreifen wolle.“
Heinrich hat Wort gehalten, denn außer einigen zahmen Xenien, in Gemeinschaft mit Carl Immermann verfasst, hat er nie wieder in diesem Versmaße gedichtet.
Na ja, möglicherweise gab es auch noch andere Gründe …
Die erwähnte Stelle bei Goethe stammt aus seiner berühmten „fünften römischen Elegie“. Das sind nun keine reinen Hexameter, sondern Distichen, aber ich denke, zwei davon darf ich trotzdem zitieren?!
Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet,
Und des Hexameters Maß, leise mit fingernder Hand,
Ihr auf den Rücken gezählt. Sie atmet in lieblichem Schlummer,
Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.
Bleibt nur noch die Frage offen, ob Maximilian Heines „Nacken“ wirklich dem goetheschen „Rücken“ entspricht?!
Aber natürlich hat auch Heine Hexameter geschrieben, sogar über Goethe, nur eben nicht bewußt, sprich: es sind Prosa-Hexameter. Ein Beispiel ist dieser Satz über den „West-Östlichen Divan“, geschrieben im Jahr nach Goethes Tod:
Lebensgenuss hat hier Goethe in Verse gebracht, und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, daß man sich wundert, wie dergleichen in deutscher Sprache möglich war.
Das sind dreieindrittel Hexameter!
Lebensge- / nuss hat hier / Goethe || in / Verse ge- / bracht, und / diese
Sind so / leicht, so / glücklich, || so / hinge- / haucht, so ä- / therisch,
Dass man sich / wundert, wie || der- / gleichen in / deutscher / Sprache
Möglich / war.
Lebensgenuss hat hier Goethe in Verse gebracht, und diese
Sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch,
Dass man sich wundert, wie dergleichen in deutscher Sprache
Möglich war.
Nun nimmt dieser Text allerdings zweimal in kurzer Folge die „metrische Lizenz“, die Ausnahmeerlaubnis in Anspruch, am Versschluss „X x x / X x“ zu ersetzen durch „X x / X x“, und das würde einem wirklichen Hexametristen kaum einfallen; aber dafür ist der zweite Vers gänzlich makellos. Und die Aussage an sich ist ja auch beachtenswert!
Ohne Titel
Da sitzen sie, die Versverzehrer,
In ihrer Hand das Messer hier
Und hier die Gabel, sehn den Kellner
Die Teller vor sie stellen, drin:
Buchstabensuppe.
Bücher zum Vers (17)
Otto Knörrich: Lexikon lyrischer Formen
Obwohl 2005 anlässlich einer Neuauflage durchgesehen und überarbeitet, ist dieses 500 Einträge und 334 Seiten starke Lexikon eher „von gestern“, denn gar nicht so wenige Einträge beschäftigen sich mit aus der Antike übernommenen Versformen, die selbst zu Zeiten der Antiken-Verehrung kaum eine Rolle gespielt haben, oder mit anderen heute vergessenen Möglichkeiten lyrischer Darstellung.
Das ist aber kein Nachteil! Im Gegenteil ist das kleine, gebundene Buch, dass sich vorzüglich überall hin mitnehmen lässt, immer für eine Überraschung gut und ermöglicht das Kennenlernen bisher unbekannter Formen ebenso wie die WIederbegegnung mit schon fast Vergessenem.
Wer sich also die Neugier bewahrt hat und immer gerne mehr von dem kennen möchte, was im weiten Feld der Dichtungs-Formen möglich ist: der weiß sich in diesem bei Kröner erschinenen Lexikon gut aufgehoben.
Die Bewegungsschule (11)
Eine letzte Veränderung des Verses bleibt zu besprechen. Eigentlich eher eine Ausnahme; aber je nach Handhabung können die Folgen für den Vers sehr beachtlich sein!
In (5) wurde das Ersetzen der beiden leichten Silben, der „ta ta“, durch eine schwächer betonte schwere Silbe besprochen, das „TAM“. Hier geht es nun darum, die Zahl der „ta“ (zwei) zu vergrößern oder zu verkleinern; und zwar jeweils um eins.
Zuerst zum „Vergrößern“, denn das ist der Fall, der deutlich weniger Folgen für den Vers hat. Ausnahmsweise ist es machbar, an beliebiger Stelle im Vers ein „ta ta“ zu einem „ta ta ta“ zu erweitern! Die einzige Bedingung dafür ist, dass dann alle drei „ta“ wirklich sehr leichte Silben sein müssen; und dass die davor und dahinter stehenden „TAM“ sehr schwer sein sollten, damit die eigentliche Bewegungslinie des Verses nicht verloren geht. Ein Beispiel:
Wen der herrliche Gesang nicht rührt, ist aus Stein!
ta ta TAM ta ta ta TAM || TAM TAM / ta ta TAM
Das liest sich ohne Schwierigkeit, und der Vers bleibt erkennbar?!
Nun zum „Verkleinern“. Dabei wird das „ta ta“ zu einem einzelnen „ta“ verkürzt; und das ist eine sehr, sehr verlockende Möglichkeit! Erlaubt sie doch die schon häufiger angesprochenen Sinneinheiten der Form „ta TAM ta“, die das Schreiben so viel einfacher machen – „das Feuer“, „im Hafen“, „er dachte“ … Allein der Druck, der dadurch vom Versanfang genommen wird, ist gewaltig!
Wird von dieser Möglichkeit sehr starker Gebrach gemacht, wandelt sich das Silbenbild des Verses:
(x) x X / (x) x X || (x) x X / (x) x X
Mit der üblichen Bedeutung: x = unbetonte Silbe, (x) = unbetonte Silbe, die stehen kann, aber nicht muss, X = betonte Silbe, || = Zäsur.
Dieser Vers ist auf seine eigene Art ein schöner und brauchbarer Vers; aber er unterscheidet sich stark von dem Vers, der bisher besprochen wurde in der „Bewegungsschule“! Der Grund liegt einmal in der Vernachlässigung des Silbengewichts, und dann auch darin, dass durch die vielen sich einfindenden „ta TAM ta“ die deutlichen Bewegungslinien blasser werden, unhörbarer; wodurch der Vers dann auch reimfähig wird, weil das Ohr nicht mehr den ganzen Vers „belauschen“ muss und will, und sich so dem Gleichklang am Versende zuwenden kann.
Solange der Vers aber als Beispielvers für die Möglichkeiten der Bewegung von Sinneinheit, Vers und Gedicht dient, möchte ich von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch machen!
Stattdessen sollte die Möglichkeit, „ta ta“ zu „ta“ zu verkürzen, sehr sparsam genutzt werden und vor allem dazu dienen, bisher noch nicht versfähigen Wörtern den Zugang zum Vers zu erlauben: ab jetzt sind auch Wörter der Form „TAM ta TAM“ dabei – „Feldsalat“, „Dosenbier“ -, und sogar die eigentlich gänzlich versfremden Wörter der Form „TAM ta TAM ta“, „Entengrütze“, lassen sich durch Inanspruchnahme gleich zweier Ausnahmeregelungen unterbringen, „Zäsurverschiebung“ und „Verkürzung“:
Ein das Lehrerzimmer erheiterndes Werk
ta ta TAM ta TAM ta || ta TAM ta ta TAM
– Wobei schon der zu betreibende Aufwand klarmacht, dass diese Wörter nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden können!
Geht es nicht um solche Wörter, sollte man der Versuchung, zu „verkürzen“, widerstehen. Sicherlich gibt es auch abseits der oben genannten Wörter noch Umstände, die zu einer Verkürzung führen können – feste Wendungen etwa:
hat er lang und breit den Kumpanen erzählt
ta ta TAM ta TAM || ta ta TAM ta ta TAM
– „lang und breit“. Dabei gilt, wie schon bei der „Erweiterung“: Die schweren, betonten Silben, die „TAM“ links und rechts des einzelnen „ta“ sollten sehr deutlich sein, damit keine Verwirrung über Bewegung und Bewegungslinie aufkommen kann.
Aber sonst: äußerste Zurückhaltung! Der Vers wird es danken durch einen lebendigen Eindruck und eine anziehende Bewegung.
So. Das war es wirklich … Ich werde aber noch mindestens eine Folge anhängen, die alles bisher vorgestellte zusammenfasst.
Das Königreich von Sede (32)
Was weht dort hoch am Flaggenmast?
Das ist des Königs Wappen –
Es zeigt zwei Narrenkappen,
Draus brennend‘ Frösche
Voller Hast
Sich werfen, hin zum Rand; der fasst
Den Satz: „Wer löschen kann, der lösche.“
Erzählverse: Der iambische Trimeter (9)
’s Fädel reißt, ’s reißt immer wieder reißt’s entzwei,
das will was heeßen! Na, was wird’s denn heeßen ernd:
als mach dich fertig, denn dein Lebensfädel, altes Weib,
wird auch ni mehr wer weeß wie lange halt’n. Der Mann
is weg. Is nunter! s‘ war a Tag, wie heute warsch,
da koama Leute, die’n nuntertrugen uf
a Schultern, und das fichtne Kästel schwamm davon,
als wie a Hobelspan in unserm Bache schwimmt.
… lässt Gerhart Hauptmann ein „am Spinnrad sitzendes altes Frauchen“, eine Gebirgsbäuerin sagen am Anfang von „Kaiser Maxens Brautfahrt“. Die wieder beginnt in Hauptmanns „Sämtlichen Werken“, Band 4 (Propyläen 1964), auf Seite 262.
Etwas seltsam wirkt es schon, wie da eher Dialekt den antiken, klassischen Vers füllt als die „Hochsprache“; aber es wirkt eben, erst recht, wenn die Trimeter des „Kaisers Max“ danebentreten, die wesentlich weniger bodenständig und bescheiden daherkommen, als er, vom Wege geirrt, in der Berghütte auftaucht:
Als wär‘ ich meines Augenlichts beraubt, als sei
tot meine Hand: denn niemand folgt auf meinen Wink!
als formt‘ ich Worte und es trüge sie kein Laut,
denn niemand ruft auf mein Gebot: Ja, hier, Herr, hier!
Nicht die besten Voraussetzungen für ein umgängliches Miteinander, könnte man meinen; doch dann taucht Anna auf, die Tochter der Bergbäuerin, und sagt Sätze wie:
Lass mich den Rock von deiner Schulter nehmen, Max.
– Es ist Liebe, beidseitig, wie aus Maxens Antwort schon vermutet werden kann:
Wie herrlich mir dies Abenteuer plötzlich scheint!
Den Schluss des Textes spricht allerdings wieder Emmerenz, allein zurückbleibend, während Anna und Max „davonspringen“:
Man is halt tot. Man stellt a Lichtel uf a Tisch
fer andre Leute, die de nich gestorben sein:
die sehn’s was in dem Lichte für a Zauber is,
und da dawider hält sich keene Finsternis.
Uns schließt sie ein.
Insgesamt ein wirksames Hin und Her, und die ganze, kleine „Idylle“ ist durchaus lesenswert; sowohl an sich, als auch in Hinblick darauf, was mit dem Trimeter alles angestellt werden kann; welche Ausdrucksmöglichkeiten er bietet.
Erzählverse: Der Hexameter (23)
Hexameter und… (1)
Der Hexameter ist ein erzählender Vers – jedenfalls, solange ein Hexameter an den anderen gehängt wird. Dann strömt die Handlung durch den einzelnen Vers wie durch die Menge der aufeinanderfolgenden Verse, und ehe man sich’s versieht, ist ein ganzes Epos hier geschrieben, dort gelesen.
Was aber, wenn man mehr lyrisch als episch dichten möchte! Muss man da auf den Hexameter verzichten?
Nicht unbedingt. Ein gangbarer Weg ist da die Verbindung des Hexameters mit einem anderen Vers, um so eine aus zwei Versen bestehende Einheit zu schaffen, die dem Gedicht dann mehr Halt gibt; die das „sich Verströmen wollen“ des Hexameters eindämmt, wenn man so will.
Welche Form dieser zweite Vers hat, ist dabei recht beliebig. Das bekannteste Beispiel ist sicher der Pentameter, der sich mit dem Hexameter zum elegischen Distichon verbindet, aber die Dichter haben auch viele andere Möglichkeiten erprobt, von denen ich hier im Faden nach und nach einige vorstellen möchte.
Den Beginn macht Friedrich Gottlieb Klopstock, also der Urvater des deutschen Hexameters – aber eben nicht nur dessen Urvater, sondern auch der vieler anderer Ideen. In „An Ebert“ verbindet er den Hexameter mit diesem dreihebigen Vers:
X x (x) / X x x / X
Dabei meint „(x)“ wie immer eine unbetonte Silbe, die stehen kann, aber nicht stehen muss. Meistens steht sie, wie in den unten folgenden Beispielen; ein Beispiel für ihr Fehlen:
So erstarb auch mein Blick!
So er- / starb auch mein / Blick!
Einige Beispiele, die verdeutlichen sollen, wie diese Zusammenarbeit zwischen Hexameter und Zweitvers aussehen kann:
Lindernde Tränen, euch gab die Natur dem menschlichen Elend
Weis‘ als Gesellinnen zu.
Wäret ihr nicht, und könnte der Mensch sein Leiden nicht weinen;
Ach! wie ertrüg‘ er es da!
Weggehn muss ich, und weinen heißt es kurz zuvor – das waren eben Zeiten, in denen auch Männer noch offen weinen durften. Grund der Klage sind die vielen Gefährten, die, wenn sie gestorben sind, Klopstock und Ebert alleine zurücklassen werden:
Wenn sich unser Vater zur Ruh, sich Hagedorn hinlegt;
Ebert, was sind wir alsdann,
Wir Geweihten des Schmerzes, die hier ein trüberes Schicksal
Länger, als Alle sie ließ?
Hagedorn, unser Vater? Muss man den heute kennen?! Nein. Aber schaden tät’s auch nicht, ein paar gelungene Gedichte gibt es schon von ihm. Schön zu sehen jedenfalls, wie die Kurzverse helfen, jeweils zwei klar unterscheidbare Untereinheiten von je zwei Versen zu schaffen! Beim elegischen Distichon (Hexameter + Pentameter) gilt es als angebracht, diese Einheiten auch inhaltlich zu beachten, und im besonderen keinen neuen Gedanken im Pentameter anzufangen und im Hexameter fortzusetzen – klar: die Grundeinheit ist eben erst ein Hexameter, dann ein Pentameter, und wofür soll diese Grundeinheit den Text vorbilden, wenn man dieser Bildung dann inhaltlich nicht folgt! Verwendet man aber, wie hier Klopstock, kürzere Verse als Zweitverse, ist dieses „zur Deckung bringen“ natürlich etwas schwieriger. Das wird hier schon erkennbar, und am Schluss des Gedichts verliert dann alles den Halt:
Finstrer Gedanke, lass ab! lass ab in die Seele zu donnern!
Wie die Ewigkeit ernst,
Furchtbar, wie das Gericht, lass ab! die verstummende Seele
Fasst dich, Gedanke, nicht mehr!
Wie immer bei Klopstock löst sich jede Ordnung in Bewegung und Empfindung auf… Ich fürchte, das ist eine Art Dichtung, die uns sehr fremd geworden ist, aber gut gemacht ist es trotzdem. Finde ich. Auch, weil die Ordnung ja nur scheinbar verloren geht …
Geschrieben hat Klopstock „An Ebert“ 1748, also mit 24 Jahren (!), und all die Menschen, die er anführt in seinem Gedicht, lebten da noch; am Schluss kam es aber, wie er es beschrieben hatte, und Ebert und er blieben allein zurück. Und auch die Verse
Stirbt dann auch Einer von uns, und bleibt nur Einer noch übrig;
Bin der Eine dann ich;
bewahrheiteten sich: Ebert starb 1795, 47 Jahre nach Entstehung des Gedichts, im Alter von 72 Jahren; Klopstock lebte noch bis 1803, ehe er 79jährig starb.
Frühlingswiese
Eine Wiese.
Hinz. Kunz.
HINZ
Den Frühling lass uns preisen, Kunz, mit Liedern,
dergleichen man noch nie vernahm!
KUNZ
Au ja!
(singt)
Die Sonne lacht, die Vöglein singen,
und aus der warmen Erde dringen
die Blumen, streben auf und blühen
und ahnen nichts von all den Kühen.
HINZ
Welch herrlich schönes, würdiges Lied! Jetzt ich!
(singt)
Die Bienen summseln durch die Lüfte,
und suchen hier und suchen da,
und stemmen’s Fäustchen in die Hüfte:
Die Blumen sind nicht länger da!
KUNZ
Wie trostlos ging es zu in dieser Welt,
wenn dein Genie nicht wär – zusammen jetzt!
HINZ und KUNZ
(singen zusammen)
Ihr lieben Bienchen, seid nicht traurig,
man fraß die Blumen, das ist wahr,
das ist zwar schrecklich und auch schaurig –
doch Frühling wird’s in jedem Jahr!
(Beide tänzeln zur Nachbarwiese, sich aus Blumen Ehrenkränze zu flechten und einander aufzusetzen)