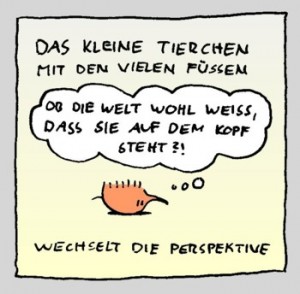Goethe verbessert
Goethe hat ein Weilchen gebraucht, bis er den Hexameter wirklich beherrschte. 1785 wurde er durch Herders Übersetzungen aus der „Anthologia Graeca“ dazu angeregt, in recht enger Anlehnung an die griechischen Vorbilder selbst einige Epigramme zu schreiben. 1799 hat er diese Epigramme dann anlässlich einer erneuten Herausgabe überarbeitet. An Schiller schrieb er:
Die Epigramme sind, was das Silbenmaß betrifft, am liederlichsten gearbeitet und lassen sich glücklicherweise am leichtesten verbessern, wobei oft Ausdruck und Sinn mit gewinnt.
Wie derlei Verbesserungen des Versbaus, die gleichzeitig auch „Ausdruck und Sinn“ auf die Beine zu helfen vermögen, aussahen, zeigt „Dem Ackermann“:
Dem Ackersmann (1785)
Eine flache Furche bedeckt den goldenen Samen,
Eine tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein.
Pflüge fröhlich und säe, hier keimet Nahrung dem Leben
Und die Hoffnung entfernt selbst von dem Grabe sich nicht.
Dem Ackermann (1799)
Flach bedecket und leicht den goldenen Samen die Furche,
Guter! die tiefere deckt endlich dein ruhend Gebein.
Fröhlich gepflügt und gesät! Hier keimet lebendige Nahrung,
Und die Hoffnung entfernt selbst von dem Grabe sich nicht.
Immer sind die Verse metrisch nicht zu beanstanden, und trotzdem gefallen mir die beiden Hexameter dieser Distichen in der jüngeren Fassung wesentlich besser. Der erste Vers hat für mich 1785 einige Probleme, begonnen bei der Zäsur.
Die ist nämlich nicht sonderlich deutlich – lautet die erste Vershälfte nun „Eine flache Furche“ oder „Eine flache Furche bedeckt“?! Ich würde die zweite Möglichkeit lesen, denn bei „Eine flache Furche“ fallen Wortgrenzen und die Grenzen der metrischen Einheiten direkt aufeinander:
Eine / flache / Furche
Dadurch verliert dieser Versteil an Spannung. 1799 hat Goethe diese Schwäche beseitigt, denn in der ersten Vershälfte schneiden sich nun die Wort- / Sinneinheiten und die metrischen Einheiten:
Flach be- / decket und / leicht
Die Zäsur ist nun sehr deutlich. Dadurch, dass Goethe von einer weiblichen Zäsur (nach einer unbetonten Silbe) bzw., je nach Lesung, von einer Zäsur in der vierten Einheit auf die männliche Zäsur (nach einer betonten Silbe) in der dritten Einheit wechselt, gleicht er den Hexameter dem folgenden Pentameter an, wodurch das erste Verspaar an Geschlossenheit gewinnt.
Auch andere Schwächen sind verschwunden! 1785 liegt die erste Hebung auf einem sehr blassen Wort, dem Artikel „Einem“. Statt des Artikels steht 1799 ein weiteres „Sinn-Wort“ in der Hebungsposition („leicht“), das inhaltlich wichtige „Flach“ eröffnet den Vers; durch das „Flach“ und das „leicht“ entsteht eine Klammer, die die erste Vershälfte heraushebt und „rund macht“.
Alt: Die beiden „ch“ von Flach und Furche folgen direkt aufeinander, was nicht so toll klingt, und der „F“-Gleichklang hat auch keinen wirklichen Grund. Neu: Der Vers beginnt mit „Flach“ und endet mit „Furche“ – nun sind diese entscheidenden Wörter so eingesetzt, dass sie durch ihre Stellung am Anfang und am Ende des Verses auch den Gesamtvers zu einer Einheit machen.
Der zweite Hexameter wird ganz ähnlich verbessert. In der jüngeren Fassung ist die erste Hälfte bis zur Zäsur wieder lebendiger durch die höhere Anzahl an Schnitten zwischen „Wort und Metrum“:
1785: Pflüge / fröhlich und / säe,
1799: Fröhlich ge- / pflügt und ge- / sät!
Die erste Vershälfte ist runder, körperlicher, klarer; die neue, männliche Zäsur leistet auch hier die Angleichung an den folgenden Pentameter. Außerdem bezieht sich das „Fröhlich“ nun eindeutig aufs Pflügen und Säen, was ja ein Vorteil ist.
Das ist nun allerdings meine Meinung. Andere denken da anders – Viktor Hehn etwa war mit dieser Änderung gar nicht einverstanden:
An anderen Stellen aber hat die Sorge für das Metrum die Anmut der sprachlichen Form ins Steife und Gesuchte verkehrt, z.B. wenn es in dem Epigramme „Dem Ackermann“ statt des früheren „Pflüge fröhlich und säe“ jetzt heißt: „Fröhlich gepfügt und gesät!“
Da ist wohl die Frage, wie man sich zu dem „imperativisch gebrauchten passiven Partizip“ stellt. Hehn empfand es als Goethe fremd und mehr zu den härteren Versen eines Johann Heinrich Voss gehörig:
Dies war eine Lieblingswendung des groben Vossischen Stiles, die sich für den Kutscher (Vorgesehen!) oder den Fronvogt (Nicht lange gefeiert!) oder den Schulmeister unter seinen Jungen (das Maul gehalten!) schicken mag, aber mitten in der Grazie der Goethe’schen Rede wie ein fremder Zusatz auffällt.
„Das Maul gehalten!“ Hm. Ich sehe schon, worauf Hehn hinaus will, aber da folge ich ihm nicht – ich finde, der Vers hat gewonnen, ohne verleugnen zu müssen, von Goethe zu sein.
Auch den Versschluss hat Goethe verbessert: Dadurch, dass die „Nahrung“ ans Ende rückt, kann eine Schlusssilbe mit tonlosem „e“, wie sie die ältere Fassung mit „Leben“ noch hatte, vermieden werden, und der Vers schwingt mehr aus, als dass er abgewürgt wird.
Wie Viktor Hehn schon deutlich machte, muss man dies alles nicht so sehen. Einer aber, dessen Urteil schwer wiegt, zeigte sich zufrieden mit Goethes Ansinnen. Schiller nämlich schrieb in seiner Antwort auf den oben angeführten Brief Goethes:
Zu den prosodischen Verbesserungen in den Gedichten gratuliere ich.
Und dann fährt er fort mit einem seiner Ausblicke aufs Große und Ganze…
Es hat mit der Reinheit des Silbenmaßes die eigene Bewandnis, dass sie zu einer sinnlichen Darstellung der inneren Notwendigkeit des Gedankens dient, da im Gegenteil eine Lizenz gegen das Silbenmaß eine gewisse Willkürlichkeit fühlbar macht. Aus diesem Gesichtspunkt ist sie ein großes Moment und berührt sich mit den innersten Kunstgesetzen.
Wie immer bei Schiller muss man das nicht glauben; aber darüber nachzudenken lohnt sich allemal.