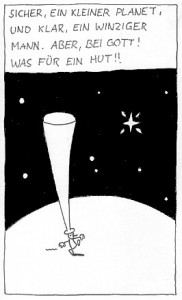Ob sich der stille Garten der Spiele des Sommers erinnert?
Um das vergessene Brett tanzen der Schnee und die Nacht.
Archiv für den Monat Januar 2014
Erzählverse: Der trochäische Vierheber (12)
Der Vierheber ist auch für der Drama benutzt worden; ein Beispiel ist „Der Kaiser und die Hexe“ von Hugo von Hofmannsthal. Der Beginn dieses Stückes liest sich so:
Eine Lichtung inmitten der kaiserlichen Jagdwälder. Links eine Quelle. Rechts dichter Wald, ein Abhang, eine Höhle, deren Eingang Schlingpflanzen verhängen. Im Hintergrund das goldene Gitter des Fasanengeheges, dahinter ein Durchschlag, der hügelan führt.
Der Kaiser tritt auf, einen grünen, goldgestickten Mantel um,
den Jagdspieß in der Hand, den goldenen Reif im Haar.
Wohl, ich jage! Ja, ich jage …
Dort der Eber, aufgewühlt
Schaukelt noch das Unterholz,
Hier der Speer! Und hier der Jäger!
Er schaudert, lässt den Speer fallen.
Nein, ich bin das Wild, mich jagt es,
Hunde sind in meinem Rücken,
Ihre Zähne mir im Fleisch,
Mir im Hirn sind ihre Zähne.
Greift sich an den Kopf.
Hier ist einer, innen, einer,
Unaufhörlich, eine Wunde,
Wund vom immer gleichen Bild
Ihrer offnen, weißen Arme …
Und daneben, hart daneben,
Das Gefühl von ihrem Lachen,
Nicht der Klang, nur das Gefühl
Wie ein lautlos warmes Rieseln …
Blut? … Mein Blut ist voll von ihr!
Alles: Hirn, Herz, Augen, Ohren!
In der Luft, an allen Bäumen
Klebt ihr Glanz, ich muss ihn atmen.
Ich will los! Die Ohren hab‘ ich
Angefüllt mit Lärm der Hunde,
Meine Augen bohr‘ ich fest
In das Wild, ich will nichts spüren
Als das Keuchen, als das Flüchten
Dieser Rehe, dieser Vögel,
Und ein totenhafter Schlaf
Soll mir nachts mit Blei versiegeln
Diese Welt … doch innen, innen
Ist die Tür, die nichts verriegelt!
Keine Nacht mehr! Diese Nächte
Brechen, was die Tage schwuren.
Er rüttelt sich an der Brust.
Steh! Es wird ja keine kommen,
Sieben sind hinab, vorbei …
Sieben? Jetzt, nur jetzt nichts denken!
Alles schwindelnd, alles schwank,
Jagen und nur immer jagen,
Nur bis diese Sonne sank,
Diesen Taumel noch ertragen!
Trinken hier, doch nicht besinnen.
Die Hexe, jung und schön, in einem durchsichtigen Gewand,
mit offenem Haar, steht hinter ihm.
Nicht besinnen? Nicht auf mich?
Nicht auf uns? Nicht auf die Nächte?
Auf die Lippen nicht? Die Arme?
Auf mein Lachen, auf mein Haar?
Nicht besinnen auf was war?
Und auf was, einmal verloren,
Keine Reue wiederbringt …?
Der Kaiser
Heute, heute ist ein Ende!
Ich will dir’s entgegenschrein:
Sieben Jahre war ich dein,
War ein Kind, als es begann,
End‘ es nun, da ich ein Mann!
…
Zu sehen, zu vernehmen ist der Kaiser Porphyrogenitus bei dem Versuch, sich von der Hexe, der er verfallen ist, loszureißen; und das, es ist nicht zu überhören, fällt ihm sehr schwer. Dementsprechend haben die Verse auch etwas zerrissenes, gehetztes!?
Am bemerkenswertesten ist sicher, wie die weitestgehend ungereimten trochäischen Vierheber immer einmal wieder in den Reim „hinüberkippen“ – erst ein Kreuzreim des Kaisers, dann ein Paarreim der Hexe, dann ein doppelter Paarreim des Kaisers -, ohne dass dies groß auffällt in der ohnehin sehr wohlklingenden Sprache der Verse. Einen Unterschied gibt es aber doch:
Die Reim-Verse schließen überwiegend betont, während in den längeren ungereimten Abschnitten zwar immer mal wieder ein betont schließender Vers auftaucht, aber eigentlich kaum häufiger, als es in Vierheber-Texten üblich ist!
Einige Ausdrücke klingen mir etwas schräg – „mit Lärm der Hunde“, „Nicht besinnen auf was war“ … Aber das hat seinen eigenen Reiz?!
Insgesamt ein schöner Text, meinem Ohr nach.
Bild & Wort (17)
Das Königreich von Sede (17)
Eingemummelt in den Mantel,
Wohlgewärmt von Schal und Mütze
Sitzt Prinz Klappstuhl nachts am Graben,
Den das Eis seit Wochen deckt;
Längst schon ist des Sommers Wärme,
Ist der Frösche träges Quarren
Fort; verweht; ein fern‘ Erinnern
In des Prinzen Geist. Das regt sich,
Wächst, wird Wunsch – doch in der Stille,
Die im Silberlicht des Mondes,
Die beim hellen Glanz des Eises
Weiter wird und sich vertieft:
Wagt der Prinz es nicht, zu quarren,
Lässt stattdessen auf die Knie sich,
Sich auf seine Hände nieder,
Spannt die Muskeln, löst sie, hüpft!
Eben wie die Frösche hüpfen
In des Sommers warmen Nächten,
Zu erbeuten, zu entkommen,
Und aus reiner Lebenslust.
Dies Gehüpfe aber Klappstuhls,
Eingemummelt in den Mantel,
Wohlgewärmt von Schal und Mütze,
Sieht vom fernen Rand des Waldes,
Sieht vom höchsten Ast des Baumes
Sich die Grübeleule an:
Unbewegt und funkeläugig.
Das Ein-Vers-Gedicht (3)
Auch unter Gotthold Ephraim Lessings „Sinngedichten“ findet sich ein Ein-Vers-Gedicht:
Grabspruch auf einen Gehängten
Hier ruht er, wenn der Wind nicht weht!
Wobei sich, wie bei allen Kurz- und Kürzestgedichten, sicher gleich die Frage nach der Überschrift stellt. Kann ein Ein-Vers-Gedicht überhaupt eine Überschrift haben?! Kommt darauf an – auf das nämlich, was drinsteht. „Grabspruch“ zum Beispiel geht in Ordnung, das ist ja nur eine Art Gattungsbezeichnung; Der „Gehängte“ ist da sicherlich viel bedenklicher, weil ohne seine Erwähnung der eigentliche Vers nicht viel Sinn macht! Ich lasse die Frage einfach mal offen und werfe einen Blick auf den eigentlichen Vers. Der weist ja doch einiges an sprachlicher Gestaltung auf:
x X / x || X / x X / x X
Metrisch gesehen ein vierhebiger Iambus, der durch einen Einschnitt angenehm geteilt wird in einen kürzeren vorderen (x X x) und einen längeren hinteren Teil (X x X x X); beide symmetrisch gebaut. Diese beiden Teile sind dann wiederum in sich ansprechend gestaltet: Das „ruht“ bildet den Mittelpunkt des ersten Teils, der entgegengesetzte „Wind“ den Mittelpunkt des zweiten Teils, der zudem bei den drei betonten Silben noch ein Alliteration zu bieten hat: we, Wi, we.
Ist das viel, ist das wenig an sprachlicher Gestaltung? Bezogen auf die Länge des Textes: Einiges, scheint mir. Wobei das dann auch so eine Frage ist – sind die sprachlichen Erscheinungen, die in einem sehr kurzen Text spürbar werden, dieselben, die auch in einem längeren Text wirken? Oder muss man anderes bewerten, gar dasselbe anders werten?! Diese Ein-Vers-Gedichte sind halt ein Grenzbereich, und da verschwimmt vieles. Was dagegen sehr klar ist: Hier ist Lessing ein wirklich gutes „Sinngedicht“ gelungen!
Ghasel vom verlorenen Glück
Als spät am Tage dicht der Regen fällt,
Dir lieblos ins Gesicht der Regen fällt:
Da gibst du endlich jede Hoffnung auf
Und stellst dich dem Gericht. Der Regen fällt
Das längst erahnte Urteil, und du weinst,
Derweil durchs letzte Licht der Regen fällt.
Erzählverse: Der Blankvers (15)
Der folgende Text stammt von Gerhart Hauptmann, ich habe ihn aus dem vierten Band („Lyrik und Versepik“) seiner „Sämtliche Werke“, erschienen 1964 bei Propyläen; da steht er auf Seite 167.
Es ist ein seltsamer Text, der aufhorchen lässt; am bemerkenswertesten ist für mich die Art, wie Hauptmann hier mit Wiederholungen umgeht, denen von Klängen ebenso wie denen von ganzen Wörtern und Ausdrücken?! Was das für Wirkungen hat, und warum: das zu ergründen lohnt sich …
Rein vom Vers her ist sicher der eine, hervor- und herausragende Siebenheber bemerkenswert!
Das Spielzeug
Der Imperator wirft sein Spielzeug hin,
ein silbernes Gerippe, auf den Tisch
von Marmor, und es schnappt und schnickt und schnalzt,
es schnellt empor und tanzt. Der Imperator,
der eben noch gegähnt und sich geräkelt,
lacht auf. Das silberne Skelettlein klirrt,
verhöhnt den Tod. Kein Totentanz, ein Tanz des ewigen Lebens
ist, was es tanzt. Am Ende rutscht es aus
und streckt mit Faxen alle viere von sich. –
Jawohl, ’s ist alles nur ein Possenspiel,
so denkt, sich schneuzend, jetzt der Imperator,
das Klapperbeinchen tanzt die Posse gut
und spaßig. Und er ruft ihm zu: „Steh auf!“ –
Da schnellt’s zwei Spannen hoch. „Der Tod“, so lallt
der Imperator, „ist ein hohler Popanz,
ein dummer Kinderschreck!“ Er lallt und lacht.
Ein dummer Kinderschreck, den Dichter hätscheln! –
Er lallt und lacht, brüllt plötzlich auf: „Du lügst!“
Meint er sich selbst? Er springt zwei Ellen hoch
und stirbt. Der kleine Silberdämon tanzt
noch immer, klirrend, klappernd, auf dem Tisch,
streckt alle viere von sich, springt empor.
Doch nicht der Imperator! Der bleibt still!
Das Spielzeug hüpft und tanzt. Genug nun, Spielzeug!
Bild & Wort (16)
Erzählformen: Das Distichon (2)
Schon ein Hexameter ist ein weiter Raum, der durchaus eine kleine Geschichte fasst; im Distichon verdoppelt sich dieser Raum beinahe, und spätestens zwei Distichen bieten dem Erzähler mehr als genug Platz! Ich versuche das an einem kleinen Doppel-Distichon zu zeigen, bei dem ich allerdings nicht genau weiß, ob es von Johann Heinrich Voss stammt oder von dessen Schwager Heinrich Christian Boie …
Die Zerstreuten
Zween tiefsinnige Freunde besprechen sich, Peter und Otto,
Und in Gedanken kratzt Otto den Peter am Arm.
Peter fragt in Gedanken: „Was kratzest Du?“ Kratzend erwidert
Otto: „Mir juckte der Arm.“ Peter versetzte: „Je so!“
Vielleicht keine überragend gute Geschichte (mir gefällt sie); aber eine Geschichte, mit Dialog und allem! Und sie zeigt auch schon, dass, wenn ein Text mehrere Distichen umfasst, das einzelne Distichon trotzdem als Einheit erhalten bleibt; denn so gut wie immer wird ein neuer Gedanke (was in der Regel meint: ein neuer Satz) in einem der Hexameter begonnen und in einem der Pentameter beschlossen. Der umgekehrte Fall – Beginn im Pentameter, Schluss im folgenden Hexameter – tritt so gut wie nie auf!
Ich schreibe noch schnell das gesamte Silbenbild hin; der nächste Text wird wieder ein wenig länger sein, ab da möchte ich es mir dann sparen beziehungsweise nur noch auf besondere Stellen eingehen!
X x / X x x / X x || x / X x x / X x x / X x
X x x / X x / X || X x x / X x x / X
X x / X x x / X x || x / X x x / X x x / X x
X x x / X x x / X || X x x / X x x / X
Zween tief- / sinnige / Freunde || be- / sprechen sich, / Peter und / Otto,
Und in Ge- / danken / kratzt || Otto den / Peter am / Arm.
Peter / fragt in Ge- / danken: || „Was / kratzest Du?“ / Kratzend er- / widert
Otto: „Mir / juckte der / Arm.“ || Peter ver- / setzte: „Je / so!“
Das einig etwas auffällige ist wohl das „Zween tief- / sinnige“ gleich am Anfang des ersten Verses?! Da steht die eigentlich schwächere Silbe „Zween“ auf einer Hebungsstelle, und die eigentlich stärkere Silbe „tief-“ auf einer Senkungsstelle. Am besten, man betont alle drei Silben im Vortrag gleich stark, eine Art „schwebender Betonung“?!
Inhaltlich wundert mich schon immer die Vergangenheitsform „versetzte“ des letzten Verses. Die könnte man ja auch einfach umgehen – „entgegnet“, oder ähnliches?
Fabelhaft
Fuchs und Gans
spielen Go,
spielen schlecht,
weiß wieso:
Fuchs hat Hunger,
Gans hat Angst.