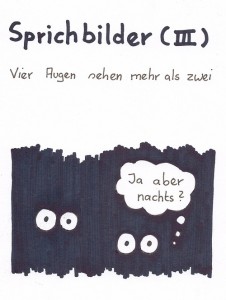Archiv für den Monat Januar 2015
Eine Begegnung im Park (2)
Als Heinrich am nächsten Tag in den Park kam, saß Dr. Sotz wieder auf seiner Bank. Diesmal hatte er seinen großen Werkzeugrucksack dabei, und überall auf der Bank und um sie herum lagen elektronische Bauteile, und mechanische, und Heinrich gänzlich unbekannte; samt Werkzeugen der verschiedensten Sorten, gängigen wie wundersamen.
Der Wissenschaftler war gerade damit beschäftigt, sich ein Pflaster um den linken Zeigefinger zu wickeln, als er des nahenden Heinrichs gewahr wurde; schnell legte er den Zeigefinger auf die Lippen, Heinrichs Schweigen einfordernd, und wies dann hinter die Bank, wo der Spielzeugroboter lang hingestreckt lag, den Kopf an einen Maulwurfshügel gepresst; und lauschte.
Eine Minute ging schweigend dahin, dann noch eine; schließlich begann der kleine Roboter zu sprechen.
„Mor“, sagte er leise; dann, schon etwas lauter, „Mor tanna mor mor tanna tara mor mor“, und endlich, wohl- und weittönend: „Tanna mor mor mor tara tanna mor mor mor!“; und Stille.
„Wissen Sie, Heinrich“, sagte Dr. Sotz, „gestern war ich sehr stolz auf das, was mein Roboter zuwege gebracht hat; doch heute Nacht, als ich noch einmal über alles nachdachte, fiel mir auf, er hat Dinge getan, die er mit dem, was ich in ihn eingebaut habe, nicht hätte tun können.“
„Wie aber dann?“, fragte Heinrich.
„Das ist die große Frage … Ich denke, es hat mit diesem Ort zu tun; mit dem Boden, wahrscheinlich. Also habe ich den kleinen Kerl noch einmal gründlich umgebaut und auf Spurensuche losgeschickt!“
„Weswegen er jetzt den Maulwürfen zuhört?!“
„Möglicherweise, eher aber etwas, das durch die Maulwurfsgänge nach oben schwingt und klingt; die Maulwürfe scheinen alle fort zu sein.“
„Dr. Sotz, es ist wunderbar mit Ihnen – da liegt der Stadtpark ruhig und still im mildesten Herbstlicht, und sie entdecken geheimnisvollste Geheimnisse nur eine Maulwurfgangslänge unter dieser Idylle! Gerade wird in der Stadt ja viel über Grundstückspreise geredet, meinen Sie, es lohnt, sich da einmal schlau zu machen?!“
Der Spielzeugroboter war aufgestanden und sah die beiden Männer an. „Mor mor mor tanna mor tanna tara mor mor“, sagte er.
„Das kann schon sein“, sagte Dr. Sotz an Heinrich gewandt. „Nur – wollen wir kaufen, oder wollen wir verkaufen?“
Erzählverse: Der trochäische Vierheber (37)
Den „Stapfen“ des Schweizers Conrad Ferdinand Meyer möchte ich „Erinnerung“ an die Seite stellen, verfasst vom zwanzig Jahre älteren Schwaben Eduard Mörike. Sind es Meyer die Blankverse, so sind es bei Mörike die tröchäischen Vierheber; auch sie sehr regelmäßig, man hat beim lauten Lesen oft Mühe, nicht zu prosaisch im Ton zu werden!
Hier also Mörikes junge Frau auf ihrem Weg, in Begleitung eines jungen Mannes, bei Regen:
Erinnerung
An C.N.
Jenes war zum letzten Male,
Dass ich mit dir ging, o Clärchen!
Ja, das war das letztemal,
Dass wir uns wie Kinder freuten.
Als wir eines Tages eilig
Durch die breiten, sonnenhellen,
Regnerischen Straßen, unter
Einem Schirm geborgen, liefen;
Beide heimlich eingeschlossen
Wie in einem Feenstübchen,
Endlich einmal Arm in Arme!
Wenig wagten wir zu reden,
Denn das Herz schlug zu gewaltig,
Beide merkten wir es schweigend,
Und ein jedes schob im stillen
Des Gesichtes glühnde Röte
Auf den Widerschein des Schirmes.
Ach, ein Engel warst du da!
Wie du auf den Boden immer
Blicktest, und die blonden Locken
Um den hellen Nacken fielen.
„Jetzt ist wohl ein Regenbogen
Hinter uns am Himmel“, sagt ich,
„Und die Wachtel dort im Fenster,
Deucht mir, schlägt noch eins so froh!“
Und im Weitergehen dacht ich
Unsrer ersten Jugendspiele,
Dachte an dein heimatliches
Dorf und seine tausend Freuden.
– „Weißt du auch noch“, frug ich dich,
„Nachbar Büttnermeisters Höfchen,
Wo die großen Kufen lagen,
Drin wir sonntags nach Mittag uns
Immer häuslich niederließen,
Plauderten, Geschichten lasen,
Während droben in der Kirche
Kinderlehre war – (ich höre
Heute noch den Ton der Orgel
Durch die Stille ringsumher):
Sage, lesen wir nicht einmal
Wieder wie zu jenen Zeiten
– Just nicht in der Kufe, mein ich –
Den beliebten ‚Robinson‘?“
Und du lächeltest und bogest
Mit mir um die letzte Ecke.
Und ich bat dich um ein Röschen,
Das du an der Brust getragen,
Und mit scheuen Augen schnelle
Reichtest du mir’s hin im Gehen:
Zitternd hob ich’s an die Lippen,
Küsst es brünstig zwei- und dreimal;
Niemand konnte dessen spotten,
Keine Seele hat’s gesehen,
Und du selber sahst es nicht.
An dem fremden Haus, wohin
Ich dich zu begleiten hatte,
Standen wir nun, weißt, ich drückte
Dir die Hand und –
Dieses war zum letzten Male,
Dass ich mit dir ging, o Clärchen!
Ja, das war das letztemal,
Dass wir uns wie Kinder freuten.
Als ich „Erinnerung“ zum ersten Mal gelesen habe, war ich noch ziemlich jung an Jahren, und der Text hat mich damals, das weiß ich noch, nicht übermäßig beeindruckt. Aber wie mit so vielen Texten Mörikes, so auch mit diesem: Liest man sie mehr als einmal, werden sie vertraut, und dann merkt man, was für wunderbare Gedichte sie sind!
Erzählverse: Der Blankvers (54)
Der Blankvers hat, wie schon häufig festgestellt, viele Freiheiten; sie gehören zu seinem Wesen. Insofern sind Texte, in denen die Verse ausnahmslos zehn Silben haben und damit immer betont enden, eigentlich schon eine besondere Spielart des Blankverses?!
Einer, der mit dieser Spielart aufs feinste umgehen konnte, war Conrad Ferdinand Meyer, er kam hier ja schon mit derartig aufgebauten Texten vor in (17) und in (40). In diesem Eintrag möchte ich ein weiteres Stück von ihm vorstellen, „Stapfen“; es ist etwas länger, und die Einförmigkeit des Verses kommt dadurch noch deutlicher zum Tragen, sein ruhiger Gang tritt noch stärker hervor – und das passt wunderbar zum vermittelten Inhalt!
In jungen Jahren war’s. Ich brachte dich
Zurück ins Nachbarhaus, wo du zu Gast,
Durch das Gehölz. Der Nebel rieselte,
Du zogst des Reisekleids Kapuze vor
Und blicktest traulich mit verhüllter Stirn.
Nass ward der Pfad. Die Sohlen prägten sich
Dem feuchten Waldesboden deutlich ein,
Die wandernden. Du schrittest auf dem Bord,
Von deiner Reise sprechend. Eine noch,
Die läng’re, folge drauf, so sagtest du.
Dann scherzten wir, der nahen Trennung klug
Das Angesicht verhüllend, und du schiedst,
Dort wo der First sich über Ulmen hebt.
Ich ging denselben Pfad gemach zurück,
Leis schwelgend noch in deiner Lieblichkeit,
In deiner wilden Scheu, und wohlgemut
Vertrauend auf ein baldig Wiedersehn.
Vergnüglich schlendernd sah ich auf dem Rain
Den Umriss deiner Sohlen deutlich noch
Dem feuchten Waldesboden eingeprägt,
Die kleinste Spur von dir, die flüchtigste,
Und doch dein Wesen: wandernd, reisehaft,
Schlank, rein, walddunkel, aber o wie süß!
Die Stapfen schritten jetzt entgegen dem
Zurück dieselbe Strecke Wandernden:
Aus deinen Stapfen hobst du dich empor
Vor meinem innern Auge. Deinen Wuchs
Erblickt’ ich mit des Busens zartem Bug.
Vorüber gingst du, eine Traumgestalt.
Die Stapfen wurden jetzt undeutlicher,
Vom Regen halb gelöscht, der stärker fiel.
Da überschlich mich eine Traurigkeit:
Fast unter meinem Blick verwischten sich
Die Spuren deines letzten Gangs mit mir.
„Ruhiger Gang“ meint nun aber keineswegs, die Verse wären langweilig – Meyer hat viel Abwechslung drin, das Ohr bekommt immer neue Beschäftigung, und einmal, in der „Wesensbeschreibung“ und gleich danach, wird der Vers auch so kräftig, wie es Blankvers-Texte oft durchgängig sind; und auch das passt und fügt sich. Ein beeindruckendes Gedicht!
Bild & Wort (119)
Bald wird gewählt
Wieder steht eine Wahl an, und wieder schmückt sich der Marktplatz
Statt mit den bunten Ständen der heimischen Händler und Bauern,
Welche, wie sie’s gewohnt sind, die blanken Äpfel und Birnen
Über die gammligen stapeln, und vor sie, damit deren Flecken
Keinen Kunden vergraulen: mit einer Rednertribüne –
Auf ihr breitet die Worte der Fremde aus, wie er’s gewohnt ist.
Bücher zum Vers (63)
Walther Killy: Elemente der Lyrik
Zuerst Anfang der 70er erschienen; meine Ausgabe hier ist 1983 bei dtv herausgekommen.
Ein schmales Bändchen, knapp über 200 Seiten im Taschenbuchformat; aber inhaltlich sehr empfehlenswert! Killy schreibt in der Einleitung über sein Buch: „Es sucht einige Grundmuster zu begreifen, welche die Lyrik immer wieder, ja immer noch gebraucht.“
Die Kapitelnamen zeigen, welche Muster das sind: „Natur“, „Addition, Variation, Summation“, „Mythologie“, „Allegorie sowie Personifikation“, „Stimmung“, „Maske“, „Kürze“.
Ich fand zum Beispiel das Kapitel „Maske“ mit den darin zu findenen Gedanken zur Bukolik sehr erhellend und anregend; aber auch die anderen Kapitel lesen sich gut!
Erläutert und verdeutlicht werden Killys Auslassungen durch viele Gedichte aus allen Zeiten und Ländern, so dass es neben dem Grundsätzlichen auch einige eher unbekannte Texte zu entdecken gibt. Vorangestellt sind dem Buch aber vier ziemlich bekannte Verse Goethes, die erste Strophe von „Elemente“:
Aus wie vielen Elementen
Soll ein echtes Lied sich nähren,
Dass es Laien gern empfinden,
Meister es mit Freuden hören?
Doch auch diese Verse liest man gerne wieder einmal …
Eine Begegnung im Park (1)
Im Park traf Heinrich Dr. Sotz; der saß seliglächelnd auf einer Bank. „Sehen Sie!“, rief er und wies auf einen Spielzeugroboter, der staksigen Schritts entlangwandelte zu Füßen des Doktors, und setzte er einen Fuß auf, sagte er etwas:
„Knie…“ (links) „…strumpf“ (rechts),
„Pflug…“ (links) „…schar“ (rechts),
„Spitz…“ (links) „…bart“ (rechts).
„Erstaunlich!“
„Sie haben noch Nichts gesehen“, entgegnete Dr. Sotz. „Schauen Sie nur weiter!“
Der kleine Roboter war stehengeblieben. Jetzt wendete er, den gekommenen Weg zurückzugehen, aber mit, ach! wie anderer Bewegung: Ein Tanz, fast. Zuerst machte er zwei kleine, enge Schritte, einen links, einen rechts; dann ein Paar weitausholender Schritte, beinahe schon Sprünge, erst mit Links, dann mit Rechts. Und er redete, nein, sang:
„Bist du Milch-Krug, bin ich Bier-Fass“ …
„Der dem Land-Vogt in die Brust schoss“ …
„Parallelwelt Seminarraum“ …
„wie ein Kohl-Kopf, der im Farn-Kraut sich versteckt hält“ …
„Erstaunlich!“, sagte Heinrich noch einmal. „Dr. Sotz, Sie verblüffen mich immer wieder. Aber, wenn die Frage gestattet ist: was genau macht Ihr kleiner Blechkamerad da eigentlich?“
Sotzens Begeisterung ließ ihn die Arme emporreißen, und er machte einen kleinen Hüpfer; und rief: „Dichten! Ich habe ihn das Dichten gelehrt!“
Erzählverse: Der Hexameter (89)
Ich habe einen weiteren Text ins „Hinterzimmer“ gestellt, eine kurze Beschreibung des Hexameters durch Johann Gottfried Herder – sicher jemand, auf den man achten kann in solchen Fragen: Die allgemeinen Regeln des Hexameters.
Und wenn ich schon gerade bei Herder bin – hier noch eine bemerkenswerte Feststellung von ihm aus seiner Rezension der Oden Klopstocks:
Sonderbar ist’s, dass selbst bei zwei Autoren in einer Sprache der Wohlklang eines Silbenmaßes nicht derselbe ist, und in seinem zartesten Wuchse kaum Vergleichung leidet. Ein Choriambe Klopstocks und Ramlers scheint bei gleich vorgezeichnetem Maße gar nicht das gleiche Ding zu sein, und man versuche nur, zwei Oden beider nacheinander zu lesen. So Klopstocks und Kleists Hexameter, obgleich beide sehr wohlklingend sind: so Klopstock und die Noachide, obgleich in der letzten Ausgabe dieser das Silbenmaß mit vieler Kunst zugerichtet worden. So Horaz und Catull, Virgil und Lukrez u.s.w. Alles wird bloß Werkzeug der Seele, die eine gewisse Farbe der Komposition, eine Stärke oder Schwäche, Fluss oder Strom auch bis ins Silbenmaß überträgt — wir wünschten die Sache mehr untersucht und tiefer charakterisiert.
„Kleists Hexameter“ – das ist der in (87) vorgestellte Vers, den Herder hier mit dem „richtigen“ Hexameter Klopstocks zusammennimmt; „Noachide“, das wird Bodmers in Hexametern geschriebener „Noah“ sein, den Lessing in (49) besprochen hat?!
Dem am Schluss geäußerten Wunsch, jedenfalls: schließe ich mich an! Da liegt viel verborgen.