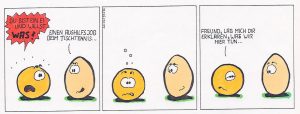Bücher zum Vers (95)
Emil Staiger: Grundbegriffe der Poetik.
Dieses vor 70 Jahren zum ersten Mal erschienene Buch erwies sich als sehr wirkungsstark in seiner Bestimmung und gegenseitigen Abgrenzung der zentralen Begriffe „Lyrik“, „Epik“, „Dramatik“. Parallel zum Bedeutungsverlust Staigers ist seit den 1960ern auch sein Buch etwas in Vergessen geraten; es liest sich aber auch heute noch sehr gut und hat vieles Nachdenkenswerte zu bieten.
Zum epischen Erzählen im Hexameter erklärt Staiger am Beispiel Homer:
„Das Gleichmaß (meint: des Hexameters) bedeutet den Gleichmut des Dichters, der keiner Stimmung verfällt, dem nicht bald so, bald wieder anders zumut ist. Homer steigt aus dem Strom des Daseins empor und steht befestigt, unbewegt den Dingen gegenüber. Er sieht sie von einem Standpunkt aus, in einer bestimmten Perspektive. Die Perspektive ist in der Rhythmik seiner Verse festgelegt und sichert ihm seine Identität, ein Stetiges in der Erscheinungen Flucht.“
Erschienen ist der Band zuletzt bei dtv.
Nicht dumm
Kluge Gedanken zu denken, ist Sache der Klugen? Wohl kaum, denn
Ist ein Gedanke klug, kümmert’s ihn nicht, wer ihn denkt!
Prosa & Vers
Zwei Zitate von Johann Wolfgang von Goethe, ein kurzer Eintrag aus „Maximen & Reflexionen“ …
Dieser schnelle Wechsel von Ernst und Scherz, von Anteil und Gleichgültigkeit, von Leid und Freude soll in dem irländischem Charakter liegen.
… und vier (berühmte) Hexameter aus „Die Metamorphose der Tiere“:
Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von Willkür
Und Gesetz, von Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung,
Vorzug und Mangel erfreue dich hoch; die heilige Muse
Bringt harmonisch ihn dir, mit sanftem Zwange belehrend.
– Die Ähnlichkeit im Aufbau lädt unwiderstehlich zu einem Vergleich zwischen Prosa und Gedicht ein: Wie bewegt sich der „freie Satz“ Goethes, wie sein „gebundener Vers“?!
Erzählverse: Der trochäische Fünfheber (18)
In seinem Band „Aus der Heimat und Fremde“ hat Friedrich Bodenstedt in dem Abschnitt „Volksweisen als Intermezzo“ auch ein „Serbisches Lied“:
Sich verglich das Mädchen mit der Sonne:
Helle Sonne, ich bin schöner als du,
Schöner als du selbst und als dein Bruder,
Als dein Bruder auch, der Mond, der klare,
Als die Sterne alle, deine Schwestern,
Die da wandeln übern blauen Himmel
Einem Hirten gleich mit weißen Schafen.
Helle Sonne hub an Gott zu klagen:
Gott, was tun mit dem verwünschten Mädchen?
Aber still entgegnet Gott der Sonne:
Helle Sonne du, mein Kind, mein liebes,
Bleibe ruhig, lass dich nicht erzürnen,
Leicht ist’s uns mit dem verwünschten Mädchen:
Glänze heißer du, verseng‘ ihr Antlitz!
Aber ich, ich werd‘ ihr Unglück schicken,
Werd‘ ihr Unglück schicken, schlimme Schwäger,
Eine böse alte Schwiegermutter!
Fühlen soll sie, wem sie sich verglichen!
Auch inhaltlich für eine gehobene Augenbraue gut, finde ich; bemwekenswerter aber die vielen Wiederholungen, die man eigentlich eher beim „kleinen Bruder“, dem ungereimten, gereihten trochäischen Vierheber antrifft?! Aber sie tun auch hier, im fünfhebigen Rahmen, ihre Wirkung!
Herbst-Cento
Klar leuchtet der Mond und so eigen und still, hoch, höher am Rande der Hügel;
Was wäre zu tun in der herbstlichen Nacht mit der Ahnung des eigenen Todes?
Ich sah der Natur in den schaffenden Bauch und beschwor ihn bei Himmel und Erde –
Was es heißt, wenn sich Trauer im Hirnstrom zeigt, geht quer durch mein Hirn bis zum Herzen …
Die Verfasser (denen mein Dank und meine Anerkennung gilt):
Gerhart Hauptmann | Adolf Friedrich von Schack
Johann Wolfgang von Goethe | Ferdinand von Saar
Heinrich Heine | Theodor Körner
Durs Grünbein | Christine Lavant
Bücher zum Vers (94)
Friedrich Schlegel: Literarische Notizen 1797 – 1801.
In diesem 1980 bei Ullstein erschienenen Band hat Herausgeber Hans Eichner alles versammelt, was sich in Schlegels Notitzbüchern dieser Jahre zu den Fragen der Literatur findet; oft nur einige Worte oder sogar einige Abkürzungen umfassende Einträge. Das liest sich durchaus spannend, und zwischen vielen der scheinbar zufälligen Gedanken lassen sich weiterführende Verbindungen knüpfen.
2037 Durch und während des Reimens soll man d i c h t e n – organisch Poesie erzeugen.
1963 In romantischen Silbenmaßen soll man gleich vollendet dichten. Ändern kann man nur in Elegien, in antikem Maß.
1824 Es liegt eine unendliche Dualität im Sonett – immer wieder von neuem. Eben darum eignet sich das Sonett zum mystischen Gedanken, zum Gebet.
1820 Die einzige gültige Beglaubigung eines Priesters ist die, dass er Poesie redet.
– Zwei „Gedanken-Paare“ zu den Fragen von Vers und Form. Der letzte ist dabei schon Übergang in die Notizen eher allgemeiner Natur:
1513 Die Verzweiflung ist die Mutter der Tiefe.
Aber es lässt sich zu sehr vielen Dingen nachdenkenswertes finden; eine Fundgrube besonderer Art.
Erzählformen: Das Reimpaar (28)
Metrisch geregelte Gedichte beziehen ihre Kraft aus dem Nebeneinander von Satz (Sprache) und Vers (Metrum); aus den unterschiedlichen Ansprüchen, die der Schreibende animmt und miteinander aussöhnt, und in deren Vereinigung das Gedicht lebt und atmet.
Keine der beiden Größen darf sich dabei aufgeben. Gedichte, in denen zum Beispiel der Satz nichts von seinen Rechten aufgibt und der Vers nur insofern eine Rolle spielt, als dass aus der Menge der möglichen Sätze die ausgesucht werden, die zusätzlich zu der vollständigen sprachlichen Richtigkeit auch die Vorgaben des Metrums umsetzen, klingen meist spannungsarm, langweilig, tot; einmal wegen des fehlenden Spannungsverhältnisses, zum anderen aber auch wegen der sprachlichen Verarmung – ein Großteil der möglichen Sätze wird ja durch das Metrum „verunmöglicht“!
Im fünften Band von Marie Luise Kaschnitz‘ „Gesammelten Werken“ (Insel 1985) findet sich auf den Seiten 125 und 126 der in Reimpaaren gehaltene Text „Vergänglichkeit“:
Ist keine Zeit so arge Zeit,
So tief ist keine Traurigkeit,
Dass nicht geheime Lebenskraft
Den Menschen sich zu Willen schafft.
Ob Feuer ihm das Haus verdarb;
Er ruht nicht, bis er’s neu erwarb.
Ob Not ihn aus der Heimat trieb;
Die fremde Erde ward ihm lieb.
Ob seinen Sohn die Kugel traf;
Er weckt sich andre aus dem Schlaf.
Ja, wenn man ihm das Herz zerbricht,
Er fühlt es nicht und weiß es nicht,
Weil unentwegt und unentwegt
Der Puls des Lebens weiterschlägt.
Und doch im Herbst ein kühler Hauch,
Ein fremdes Lied, ein bittrer Rauch
Genügt, dass seine ganze Welt,
Die blühende, zu Staub zerfällt.
„Er weckt sich andre aus dem Schlaf“ – ob dieser Ausdruck, dieser Satz ohne das Einwirken von Metrum und Reim so geschrieben worden wäre? Auch der Satzbau gleich des ersten Verspaars zeigt die angesprochene Spannung, und so vieles in diesen neun Verspaaren.
Erzählverse: Der Blankvers (86)
Die Eulen schrein
Die Eulen schrein. Es schmerzt wie Geierbiss
Ratloser Reue dieser hohle Ton
Der nächt’gen Vögel dumpf und heiß im Hirn.
Die leere Nacht stöhnt: stumm, doch atemschwer.
Mir ist, als atmete ihr Schlund den Rest
Von Glück ein, den ein leerer Tag mir ließ.
Ein schwerer, harter Text von Otto Julius Bierbaum, auch durch seine ausschließlich männlich endenden, ungereimten iambischen Fünfheber. Erstaunlich, wie stark er trotzdem an einige leichte Hexameter aus Christoph Martin Wielands „Frühling“ erinnert:
… Schon rauschen von Ferne die Flügel
Der entfärbenden Nacht; die Sonne sinkt hinter dem Gipfel
Purpurner Berge hinab, noch scherzen in ihrem Strahle
Sorglose Eulchen dem Tod entgegen und atmen des Lichtes
Süßen Überrest ein. …
Was an den verwendeten Wörtern liegen muss: Nacht, einatmen, Rest, Eulen / Eulchen, Glück / Licht, ratlos / sorglos, schmerzt / scherzen; wobei die letzten beiden Paare, inhaltlich gegensätzlich, auf die ganz verschiedenen Stimmungslagen der Texte hinweisen?! Auch spannend zu sehen, was wie ein Beiwort wie „leer“, wie eines wie „entfärbend“ die „Nacht“ näher bestimmt …
Go: Die alten Meister (53)
Den alten Meistern fielen
Herbstblätter wie ein Rat
Aufs Brett: Geht drinnen spielen.