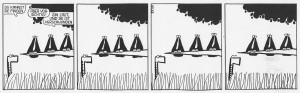Wenn den Ziegen und den Lachsen
Noch und nöcher Federn wachsen,
Wächst in Lachsen und in Ziegen
Auch die Sehnsucht, fortzufliegen.
Die Bewegungsschule (52)
Ich habe den Abend damit verbracht, in Stefan Zweigs „Der Kampf mit dem Dämon“ zu lesen. Zu Friedrich Hölderlins Gedichten sagt Zweig unter anderem:
Diese Entwicklung zur Freiheit, dieses Sich-Losreißen, Sich-Selbstherrlichmachen des Rhythmus (auf Kosten der Bindung und geistigen Ordnung) geht im Hölderlinschen Gedichte ganz allmählich vor sich: zuerst hat er den Reim, die klirrende Fußkette von sich gestoßen, dann das über die breitatmende Brust zu enge Kleid der Strophe gesprengt; antikisch nackt lebt nun das Gedicht seine körperhafte Schönheit aus und eilt wie ein griechischer Läufer dem Unendlichen entgegen. Alle gebundenen Formen werden dem Inspirierten allmählich zu enge, alle Tiefen zu seicht, alle Worte zu dumpf, alle Rhythmen zu schwertönig – die ursprünglichste klassische Regelmäßigkeit des lyrischen Baues überwölbt sich und bricht, der Gedanke schwillt immer dunkler, mächtiger, gewitterhafter aus Bildern empor, immer tiefer und voller wird gleichzeitig das rhythmische Atemholen, großartig kühne Inversionen binden oft ganze Strophenreihen in einen Satz zusammen – aus den Gedichten werden Gesänge, hymnischer Anruf, prophetische Schau, heroisches Manifest.
Ja … Etwas weniger wortgewaltig gesagt: An Hölderlin führt, macht man sich Gedanken über die Art, wie sich Verse bewegen, kein Weg vorbei; und auch wenn es viele Gründe gibt, eine Hölderlin-Ausgabe im Schrank zu haben – seine wunderbare Bewegungs-Kunst ist darunter nicht der schlechteste.
Nochmal Zweig:
Die ersten Zeilen seiner Hymnen haben immer etwas vom Kurzen, Abrupten, Losschnellenden eines Abstoßes, das Verswort muß immer erst fort von der Prosa des Daseins, um sich einzuschwingen in sein Element. … Hat sich Hölderlin aber einmal in die Begeisterung abgestoßen, so flutet ihm der Rhythmus gleichsam wie feuriger Atem von der Lippe, wunderbar bindet sich in kunstvollen Verschränkungen die schwere Syntax, die blendendsten Inversionen kontrapunktieren sich mit einer strahlenden, einer zauberhaften Leichtigkeit: durchsichtig wie feinster Stoff, wie die gläserne Schwinge eines Insektes lässt das „wehende Lied“ durch seine klingenden, leuchtenden Flügel den Äther und sein unendliches Blau fühlen.
Erzählformen: Das Sonett (14)
Im Traum sah ich ein Männchen klein und putzig,
Das ging auf Stelzen, Schritte ellenweit,
Trug weiße Wäsche und ein feines Kleid,
Inwendig aber war es grob und schmutzig.
Inwendig war es jämmerlich, nichtsnutzig,
Jedoch von außen voller Würdigkeit;
Von der Courage sprach es lang und breit,
Und tat sogar recht trotzig und recht stutzig.
„Und weißt du, wer das ist? Komm her und schau!“
So sprach der Traumgott, und er zeigt mir schlau
Die Bilderflut in eines Spiegels Rahmen.
Vor einem Altar stand das Männchen da,
Mein Lieb daneben, beide sprachen: Ja!
Und tausend Teufel riefen lachend: Amen!
Der Traum ist eine Welt eigenen Gesetzes, wer in ihr und aus ihr erzählt, muss sich an dieses Gesetz halten. Heinrich Heine bleibt in diesem, seinen „Traumbildern“ zugehörigen Sonett nah der Wirklichkeit, und auch die Sonettform vernachlässigt er nicht: Die beiden Quartette sind eng aufeinander bezogen und durch das „inwendig“ unmittelbar verbunden; die Terzette davon klar geschieden und wiederum unter sich mit unterschiedlichen Teilen der Erzählung gefüllt, wobei der nach- und eindrückliche letzte Vers einen schönen Schlusspunkt setzt. Ein feines Beispiel für das Zusammengehen von Form und Inhalt, und für das Zusammengehen von „Sonett“ und „Erzählung“ auch!
Erzählformen: Das Distichon (19)
Im Sommer dieses Jahres ist bei Klöpfer & Meyer „Haydns Papagei“ erschienen, ein Gedichtband von Susanne Stephan. In dem lyriktypisch dünnen, schön gemachten und sehr lesbaren Buch findet sich auf Seite 22 „Discount“, ein Text, der zusätzlich mit der Kennzeichnung „Elegie“ versehen ist; was zumindest einen Anfangsverdacht in Bezug auf das Distichon zulässt! Und tatsächlich ist gleich der erste Vers ein schöner Hexameter:
Siebenundzwanzig wie Trakl, wie Joplin, Hendrix, verunglückt,
– Danach folgt aber kein wirklicher Pentameter, und auch die folgenden Verse erinnern eher von fern ans „elegische Maß“, bis:
…
Siebenundzwanzig, Amy, und diese gewaltige Stimme,
die mich findet und greift, Lied aus dunklem Gewölk
nahe den Instant-Suppen, dem luftdicht einzeln Foliertem,
die zu groß ist für uns, unsere Körper und treibt,
fegt hier alle und alles hinaus nur wohin aus der Halle
…
Zweieinhalb sehr saubere, sehr schöne Distichen von feiner Bewegung, nach denen der Text sich dann wieder mit Anklängen an die Bewegungswelt des Distichons begnügt. Aber auch so: Ein schönes Beispiel dafür, wie Distichen im Jahre 2015 aussehen können, und welche Wirkungen mit ihnen zu erzielen sind! („Foliertem“ steht so im Text, seltsamerweise.)
Das Königreich von Sede (78)
Schemel schaut auf seine Hände,
Schaut auf seine leeren Hände:
Keine Laute, drauf zu spielen,
Keine Schrift, darin zu lesen,
Teller nicht und Flasche nicht –
Nur die alten Narrenhände,
Blaugeädert, dürr und knochig,
Unbeschäftigt ihm im Schoß.
Schemel lächelt und erhebt sich,
Geht zum Schlosstor und durchschreitet’s,
Kommt zum Graben, wo die Frösche
Springen auf der Jagd nach Fliegen,
Nützlich sind die Glieder ihnen,
Nimmermüde Arm wie Bein …
Schemel späht nach einer Fliege,
Und, wie er’s in ferner Jugend
Gerne tat, mit beiden Händen
Unversehrt sie zu umfangen
Sucht er, und gelingt’s, zum Ohr hin
Sie zu heben, und jetzt hört er
Wütendes Gebrumm: Ich bin!
Erzählformen: Das Distichon (18)
Im zweiten Vers eines Distichons, dem Pentameter, treffen im ursprünglichen, griechischen Vers in der Mitte zwei lange Silben aufeinander. Im Deutschen werden diese beiden Silben meist durch zwei benachbarte betonte Silben nachgebildet, womit dann sehr häufig auch ein tieferer inhaltlicher Einschnitt einhergeht – eine der beiden betonten Silben gehört nach hüben, eine nach drüben:
Feuer und Nebel im Blick – Himmel und Roma vor mir!
Ein Beispiel von Wilhelm Waiblinger, aus seiner Elegie „St. Onofrio“. Einige Jahre zuvor hatte Waiblinger aber schon gezeigt, dass dieser Sinneinschnitt keineswegs Gesetz ist!
Der Geizige
Nach Lucillius Epigr. 103
Harpax verlor unlängst eine Summe Geldes im Traume;
Grimmig erwacht‘ er, und sprang auf, und erhängte sich selber.
Die beiden „langen“ (griechisch betrachtet) beziehungsweise „betonten“ (deutsch betrachtet) Silben sind „sprang“ und „auf“; aber von einem Einschnitt zwischen ihnen kann überhaupt keine Rede sein, vielmehr reißt es den Satz mit der rhythmisch nachdrücklichen Sinneinheit ◡ — —, „und sprang auf“, geradezu hinweg über die Versmitte; und der Pentameter zeigt dabei einmal eine gut zum Inhalt passende, dann aber auch eine sehr anziehende Bewegung!
Go: Die alten Meister (37)
Die alten Meister sehen,
Was ihnen nützt, voraus;
Und lassen es geschehen.
Erzählformen: Das Distichon (17)
Adolf Stahr hat selbstredend auch vorzeigbare Verse geschrieben. Seine Distichen zum Beispiel sind meistens gut lesbar! Die folgenden drei stammen aus dem „Buch der Freundschaft“ überschriebenen Teil seiner gesammelten Gedichte, der „Gelegenheitsgedichte an Personen“ enthält. „An Adolf Jerichan und Elisabeth Baumann“ richtet er dabei aus Rom folgende drei Distichen:
Was sich der Knabe geträumt im Märchentraume der Kindheit,
Was dem Jünglinge dann höher den Busen geschwellt,
Was der reisende Mann als Krone des irdischen Daseins
Oft in stillem Gebet heiß von den Göttern erfleht –
Endlich ward es gewährt: mit dürstenden Augen zu schauen
Himmel und Erde und Meer, die sich die Schönheit geweiht.
Über diese Art zu schreiben ist die Zeit hinweggegangen; aber die Sprache bewegt sich trotzdem sicher und fest im Rahmen der Verse, und das Lesen und Sprechen ist daher eine keinesfalls unangenehme Beschäftigung!
Die Vorratskammer
Adolf Stahr (1805 – 1876) war zu seiner Zeit ein auf vielen Gebieten tätiger Schriftsteller und dabei durchaus nicht erfolglos. Seine Gedichte allerdings, durch die ich mich gerade lese, sind … nicht so überzeugend. Eines schließt mit diesem Vers:
Mein Herz an dem Deinen aus Winter und Nacht
Wird da dem Herzen des / der Angeredeten bescheinigt, „aus Winter und Nacht“ zu bestehen? Das kitzelt das Ohr schon ein wenig! – Leider nicht; die gesamte zweite und letzte Strophe von „Frühlingshoffnung“ (ein Titel, der gedichtlich eher wenig Hoffnung macht) liest sich so:
Die Sonne geht unter, die Sonne geht auf
In des Daseins ewig hinkreisendem Lauf,
Durch ihre Macht
Zum Leben erwacht
Mein Herz an dem Deinen aus Winter und Nacht.
Öhöm. Aber man soll ja nichts verkommen lassen; ich nehme mir also den letzten Vers und packe ihn in meine dichterische Vorratskammer; da bleibt er liegen, bis ich bei Gelegenheit ein Cento schreibe oder einen anderen Text, in den ein solcher Vers passt – da wird er dann mit Verfasserangabe erscheinen, aber unter willentlichem Verschweigen der restlichen vier Verse …
(Für sich alleine, außerhalb des Rahmens einer Reimgedicht-Strophe: kann man diesen Vers als Vertreter der „Bewegungsschulen-Verses“ verstehen, wie ihn die hauseigene „Bewegungsschule“ nennt; außerhalb derer er allerdings als „Anapästischer Dimeter“ geführt wird.)