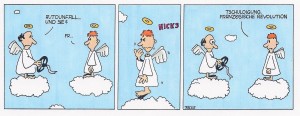Guido Eckardts „Träumende Herzen“ ist – man sehe mir das harsche Wort nach – ein vollkommen bedeutungsloses Gedicht. Ein großes Wort, „Herz“; der Dreischritt „Morgen, Mittag, Abend“ mit anschließendem Schwenk hin zum Tod; und der Reim, der die Strophen lautlich zusammenhält – wenn das alles zusammenkommt, gelingt das Vortäuschen von Sinn gut:
Träumende Herzen –
Wer nimmt sie in Acht,
Früh wann der klingende
Morgen erwacht?
Flammende Herzen –
Wer hält sie in Hut,
Rings in der zitternden
Mittagsglut?
Bebende Herzen –
Wer lindert die Pein,
Läuten die Glocken
Den Abend ein?
Schlafende Herzen –
Freundlich bewacht,
Ruhen in stiller
Grabesnacht.
– Aber da ist ja auch noch der gewählte Vers, der Zweiheber; und der lässt mit dem nun schon hinlänglich bekannten Verfahren, die unbetonten Silben frei um die beiden betonten Silben jedes Verses anzuordnen, wenigstens ein wenig frischen Wind durch das ansonsten trockene und steife Gebilde wehen!