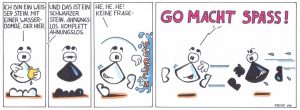Mit der Vorsilbe „ent-“ werden, und vor allem: wurden viele schöne Verben gebaut. „Entmuten“ zum Beispiel ist heutzutage ein technischer Begriff; früher stand es oft anstelle von „entmutigen“. Als ich im „Online-Grimm“ dieses Wort nachschaute, fanden sich dort wunderbare „Ent-Verben“ die Menge – „entnasen“ zum Beispiel, das in einem schönen Distichon auftaucht – und dabei gleich einen Freund mitbringt:
Alte, verwitterte Steine mit unerklärbaren Schriften,
Urnen voll Asche und Sand, Büsten, entnast und entohrt;
– So zu finden in Johann Jakob Jägles „Gedichten“. Die wahrscheinlich unübertroffene Höchstleistung ist in dieser Hinsicht aber die von Friedhelm Kemp stammende Übersetzung eines Verses von Pierre de Ronsard:
Je n’ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé
Ich bin nur noch Gebein, mein eigner Knochenmann,
Entmarkt bin ich, entsehnt, entmuskelt und entfleischt
Das hat eine beachtliche Überzeugungskraft!
Von daher: Ruhig einmal darauf achten, was einem so alles an „Ent-Verben“ begegnet beim Lesen; und dann auch den Mut haben, nach eigenem Gefallen neue Vertreter dieser Art selbst zu bilden und einzusetzen!