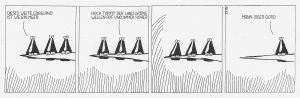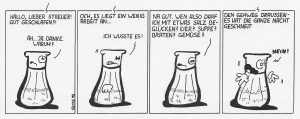Des alten Meisters Zählen
Ergibt, dass kurz vor Schluss,
Er seufzt: zwei Punkte fehlen.
Erzählformen: Das Distichon (65)
„Der Markt und der Hafen“, von Peter Treschow Hanson, ist ein eigenartiger Text. Kein guter, aber einer, der die Zweigliedrigkeit des Distichons auf überraschende Art nutzt:
Stöhnend ziehet den Karren das Gaul und es knarren die Räder;
Still vor’m säuselnden Wind teilet die Wellen das Schiff.
Ärgerlich schwinget die Peitsch‘ der verdrossene, mürrische Treiber;
Unter ermunterndem Ruf hebt sich das Segel und fällt.
Ach! wie es schüttelt und holpert in Kot auf den Steinen der Straße!
Wiegend trägt und der Flut ebene Fläche daher.
Kärgliche Last in dem Wagen, doch schwer und unwürdig des Schleppens!
Reichliche, köstliche Fracht füllet die Höhlung des Schiffs.
Dort stumpft ab sich der Blick an den kärglichen Früchten des Nordens;
Hier erlabet des Süds üppige Sendung den Sinn.
Arbeit und strebender Fleiß schützt zwar vor darbendem Mangel,
Aber zu frohem Genuss leiten nur Kühnheit und Geist.
„Das Gaul“ ist vielleicht ein Schreibfehler – „der Gaul“, „das Maul“? Es kommt nicht darauf an …
Spannender ist da schon, wie der in Distichon immer wieder anzutreffende Gegensatz nicht zwischen Hexa- und Pentameter auftritt, sondern zwischen allen Hexametern, die das eine Bild, und allen Pentametern, die das andere Bild enthalten!
Nun hat der Text Mängel in der Bildlichkeit, und er führt den Gegensatz auch zu lange fort (ein Distichon, oder sogar zwei Distichen weniger zu nehmen, wäre vernünftig gewesen – der Leser langweilt sich bei Wiederholungen immer schneller als der Verfasser), und das Bild führt nur unzureichend auf das Schluss-Distichon hin (das, eigentlich, auch für sich alleine stehen könnte), und es leuchtet nicht ein, warum der bewegtere, rhythmisch freiere Hexameter das Mühsame des Lastkarrens, der engere, einförmigere Pentameter aber die Freiheit des Frachschiffes darstellen soll; gleichviel! Einen so aufgebauten Text sieht man nicht oft, und es ist eine weitere Anregung, was man mit dem Distichon alles anstellen kann.
Ein Fußnoten-Gedicht
Davon habe ich schon einige vorgestellt, hier und hier; dieses ist von Johann Nikolaus Götz.
Auf Dianens Bildsäule
Es beschäftigt selbst im Jagen
Amor ihre ganze Seele.
Unerachtet ihrer Miene voller Unschuld
Ist sie dennoch von dem Pfeile
Noch verwundet, den ihr Latmus *)
Schöner Schäfer in dem Herzen hinterlassen.
*) Latmus: Ein Berg in Karien, wo Diana den Endymion schlafend fand.
Beachtenswert, wie daraus hervorgeht, was beim Leser vorausgesetzt wird: Die Geschichte von Diana und Endymion, das antike Königreich Karien (heute in der Türkei) – aber nicht der Name des Berges …
Einen zweiten Blick wert sind auch die ungleich langen trochäischen Verse, die Götz hier verwendet, ungereimt und mit der ihm eigenen, anziehenden Nachlässigkeit.
Das Königreich von Sede (97)
Frösche sitzen auf den Steinen,
Unbeweglich, und sie weinen
Tränen, große; dann die kleinen;
Und dann keine mehr.
Nennten sie der Tränen Gründe,
Keinen gäb’s, der sie verstünde,
Ist’s doch lange her.
Frösche sitzen, unbeweglich,
Auf den Steinen, wo sie täglich
Weinen, und sie schauen kläglich,
Tränenschwer die Welt:
Die der andern, und vertrauen
Darauf, dass, was Menschen bauen,
Endlich schwankt und fällt.
Erzählformen: Das Distichon (64)
Die Dichter reden bekanntlich nicht über sonderlich viele Dinge; sie tun es nur auf sehr unterschiedliche Weise. Am Neujahrstag habe ich Winterleben von Karl Rudolf Tanner eingestellt; heute geriet mir dieses Doppeldistichon von Wilhelm Gerhard in die Hände:
Langsam rollt die Kalesche den Hügel hinauf und hinunter,
Nichts als Wolken und Schnee bietet dem Blicke sich dar.
Dennoch wandelt im Grünen des Geistes feuriges Auge,
Und die erstarrete Hand folgt mit dem Griffel ihm nach.
Bei allen Unterschieden doch so ähnlich, dass mich das eine an das andere erinnert hat.
Erzählformen: Das Distichon (63)
Heute habe ich einen Zettel weggeräumt, auf dem ich mir ein Distichon Wilhelm Waiblingers notiert hatte, aus seinem Gedicht „Auf dem Lago Maggiore“:
Himmel und Sterne dort oben und Himmel und Sterne hier unten,
Dunkel und Tiefen und Licht lachen wie Engel sich an.
Formal ist nichts besonderes an ihm, bis vielleicht auf den Umstand, dass alle Einheiten dreisilbig besetzt sind, was ja nicht ganz so häufig vorkommt; inhaltlich ist es typisch Waiblinger, immer leicht und unbefangen, mehr auf das große Wort als auf den genauen Ausdruck vertrauend. Manchmal leiden seine Distichen-Texte darunter, aber hier passt es, finde ich, und der Text nimmt den Leser gerade durch diese Unbefangenheit für sich ein?!
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum ich mir dieses Verspaar herausgeschrieben habe. Herrje.
Bücher zum Vers (99)
Paul Böckmann: Formensprache.
Wieder einmal kein wirkliches „Vers-Buch“ (erschienen 1966 bei Hoffmann & Campe); aber doch bemerkenswert genug. Es enthält zum Beispiel „Hölderlins Naturglaube. Zur Interpretation des Archipelagus-Gedichts“, und dieser Text zu Hölderlins wunderbarem Hexameter-Text beginnt so:
Wie alle große Lyrik lebt auch diejenige Hölderlins zunächst und vor allem aus der Einmaligkeit ihrer sprachlichen Prägung. Es ereignet sich hier das der Lyrik eigene Wunder, dass sich in Gedichten von wenigen Verszeilen die der Sprache eigene Unendlichkeit mit der des Lebens so vermählt, dass die Worte in sich selber schwingen und im Hersagen sich ständig erneuern.
Nur auf das letzte Wort geschaut, „erneuern“: Was macht denn dann nicht-große Lyrik mit den Worten, was Nicht-Lyrik? Nutzen sie die Worte ab? Verbrauchen sie sie?!
Unschöne Vorstellung … Aber wie sagt Hölderlin im „Archipelagus“:
Deiner Inseln ist noch, der blühenden, keine verloren.
Streiche „Inseln“; setze „Worte“.